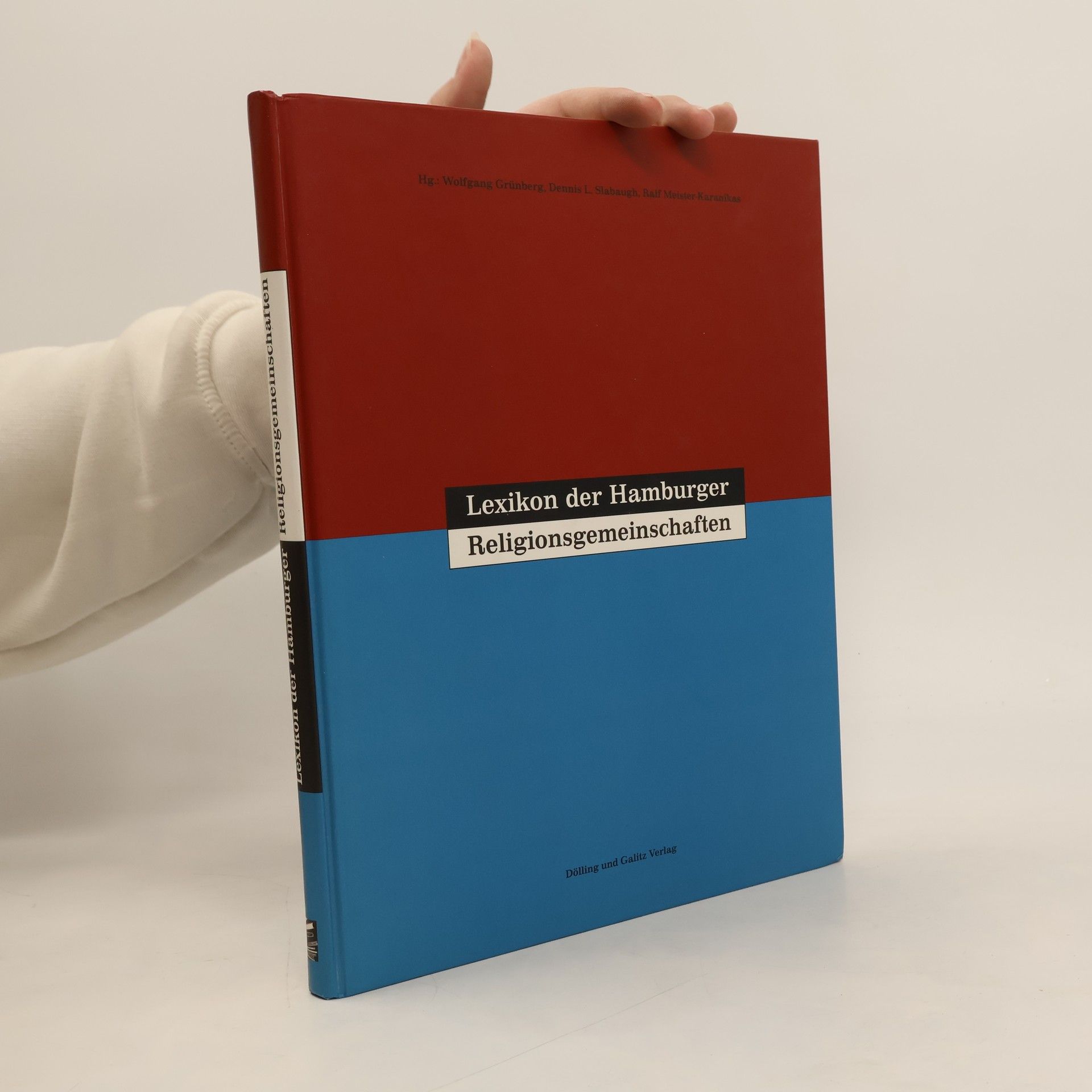Die Großstadt Hamburg weist eine multireligiöse Landschaft auf, die von großen, traditionsreichen Körperschaften bis hin zu kleinen, konfessionellen Gruppen und Kleinstgemeinschaften mit unklarem rechtlichen Status reicht. Diese Vielfalt prägt das moderne Stadtbild, in dem zahlreiche religiöse Organisationen nebeneinander existieren und teilweise miteinander konkurrieren. Das Lexikon der Religionsgemeinschaften in Hamburg dokumentiert diese interreligiöse Koexistenz und stellt alle erfassten Religionsgemeinschaften im Stadtgebiet mit ihren Geschichten, Glaubensinhalten, Rechtsformen, Kultorten und Mitgliederzahlen vor. Über 100 nichtkommerzielle Religionsgemeinschaften wurden identifiziert und charakterisiert. Historische Karten veranschaulichen die religiöse Pluralisierung und zeigen den Zusammenhang zwischen Stadtwachstum und Religionsentwicklung. Die Herausgeber sind Dr. Wolfgang Grünberg, Professor für Praktische Theologie an der Universität Hamburg und Leiter der „Arbeitsstelle Kirche und Stadt“, sowie Dennis L. Slabaugh, Ph.D., Kirchenhistoriker und ordinierter Prediger der Mennonitengemeinde, und Ralf Meister-Karanikas, Pastor der Nordelbischen Ev.-Luth. Landeskirche, beide ebenfalls Mitarbeiter der „Arbeitsstelle Kirche und Stadt“.
Wolfgang Grünberg Libros
10 de agosto de 1940 – 13 de agosto de 2016