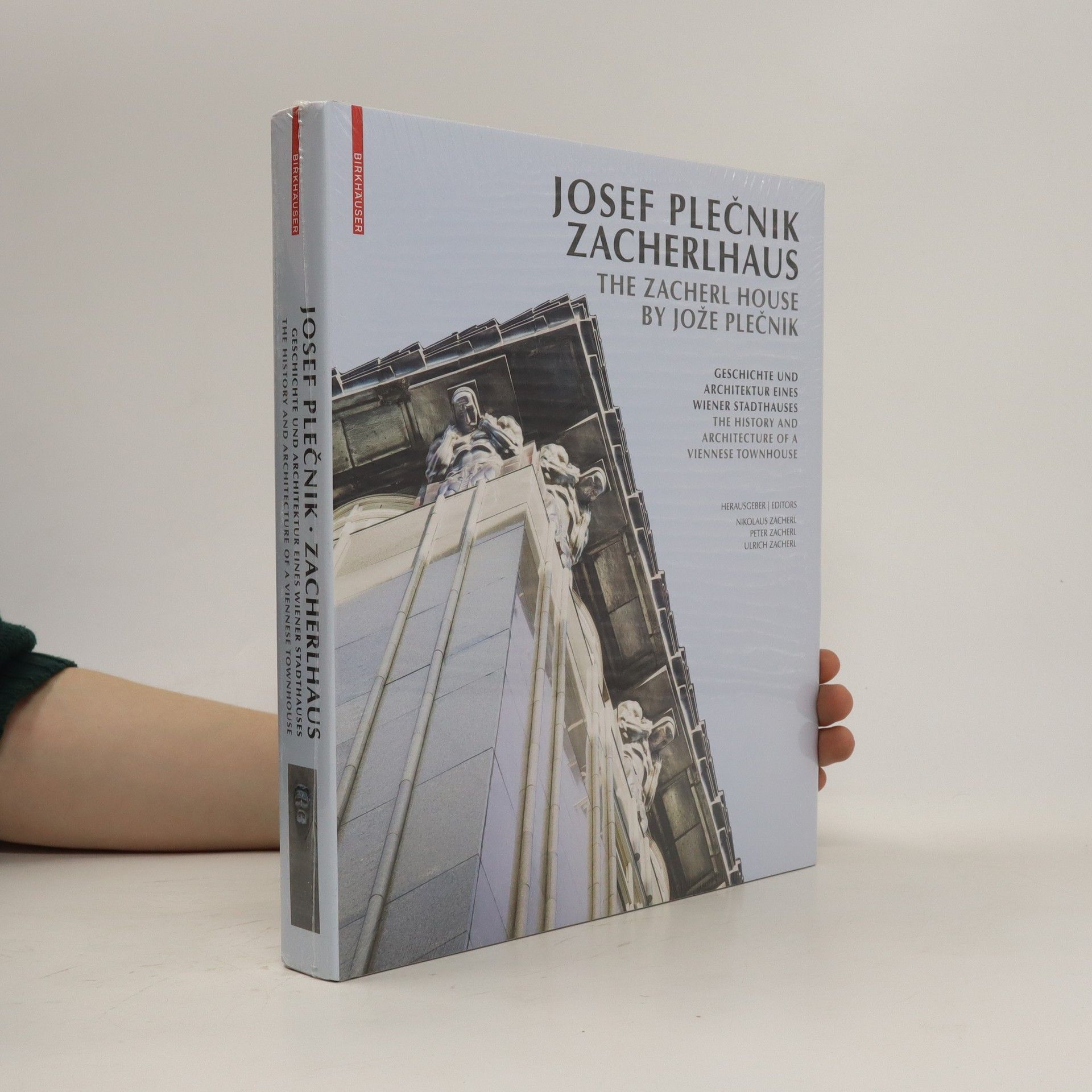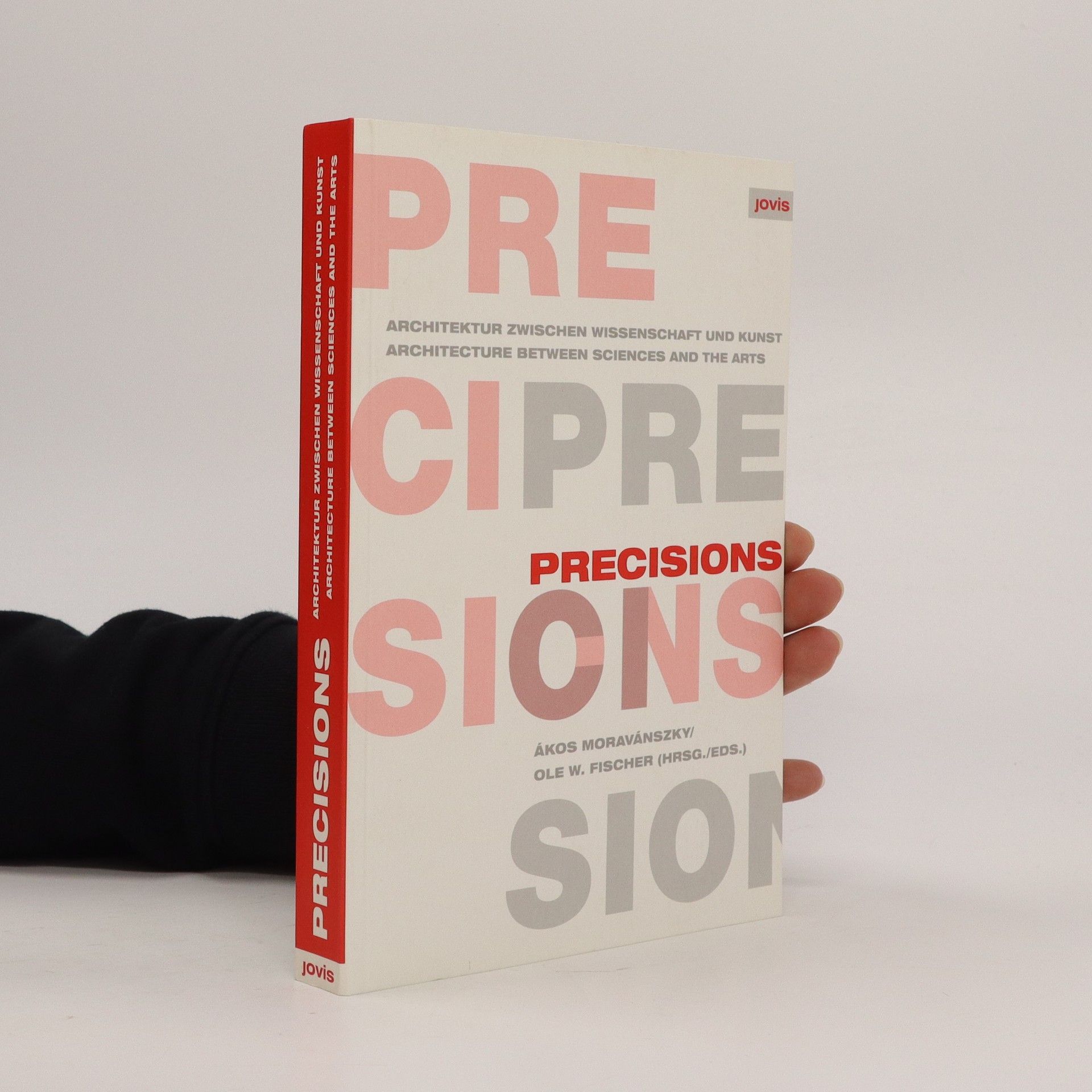Precisions - Architektur zwischen Wissenschaft und Kunst - Architecture between sciences and the arts
- 271 páginas
- 10 horas de lectura
Where is the place of architecture? Closer to the arts or to the sciences? And has there been a shift of this position over the past years due to technological evolution? Well-known authors explore the subject from different angles: from digital design strategies in lightweight construction to filigree architectural projects.