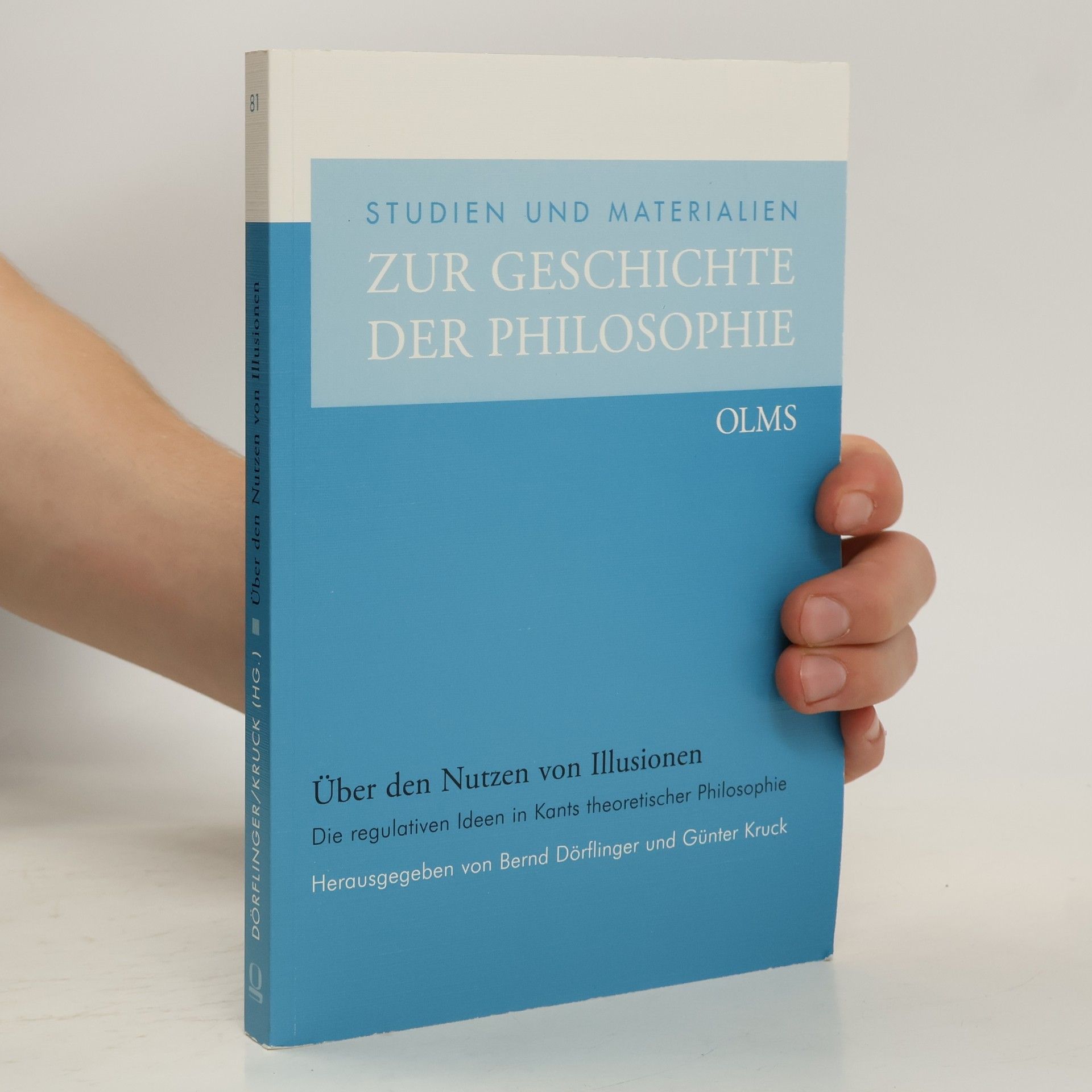Über den Nutzen von Illusionen. Die regulativen Ideen in Kants theoretischer Philosophie.
- 164 páginas
- 6 horas de lectura
Kant betrachtet das denkende Ich, das Weltganze und Gott als bloße Ideen, die zwar von der Vernunft gedacht werden, jedoch keine realen Entitäten darstellen. Diese Ideen sind nicht überflüssig, da sie der empirischen Erkenntnis Orientierung bieten. Der Band analysiert Kants regulative Ideen und deren Implikationen.