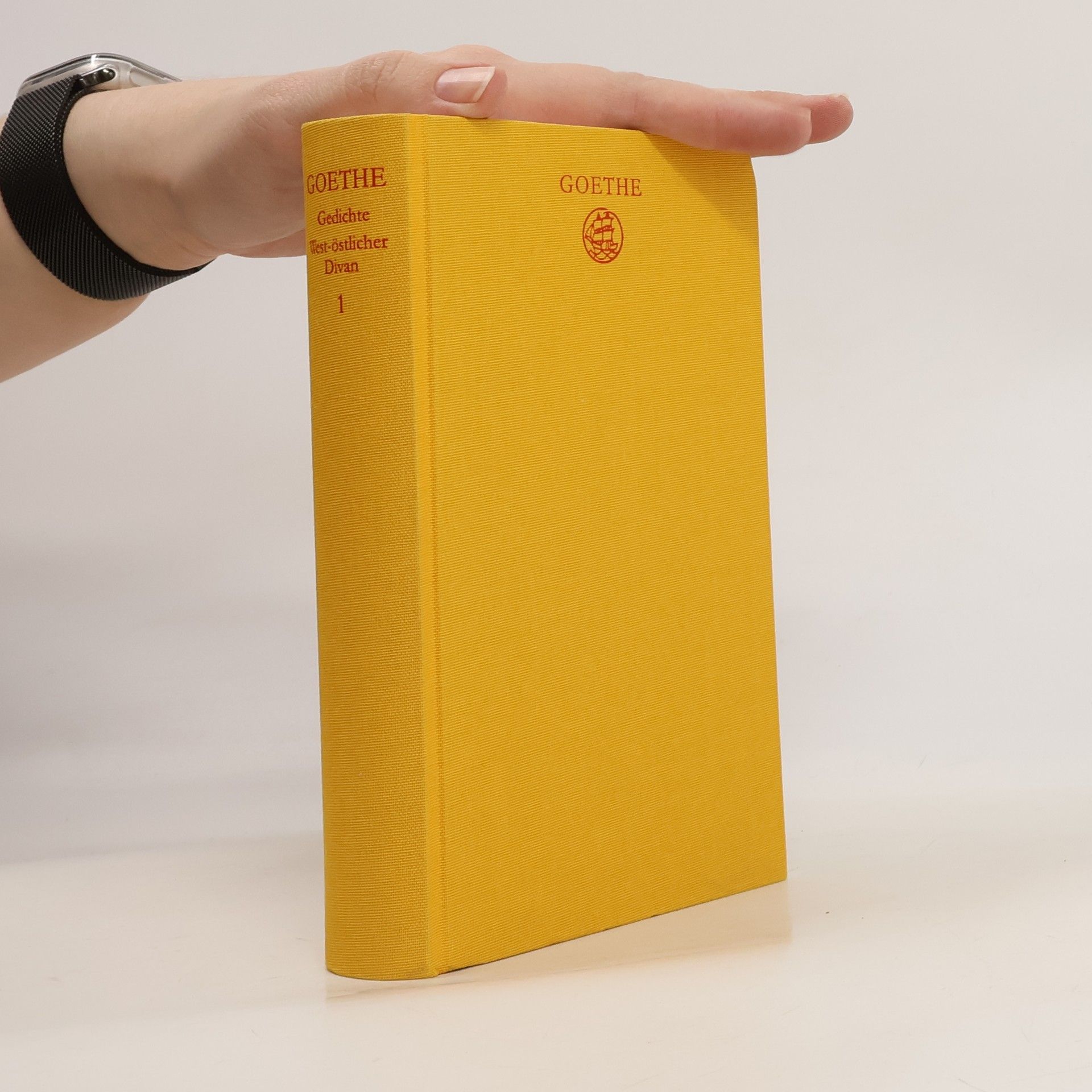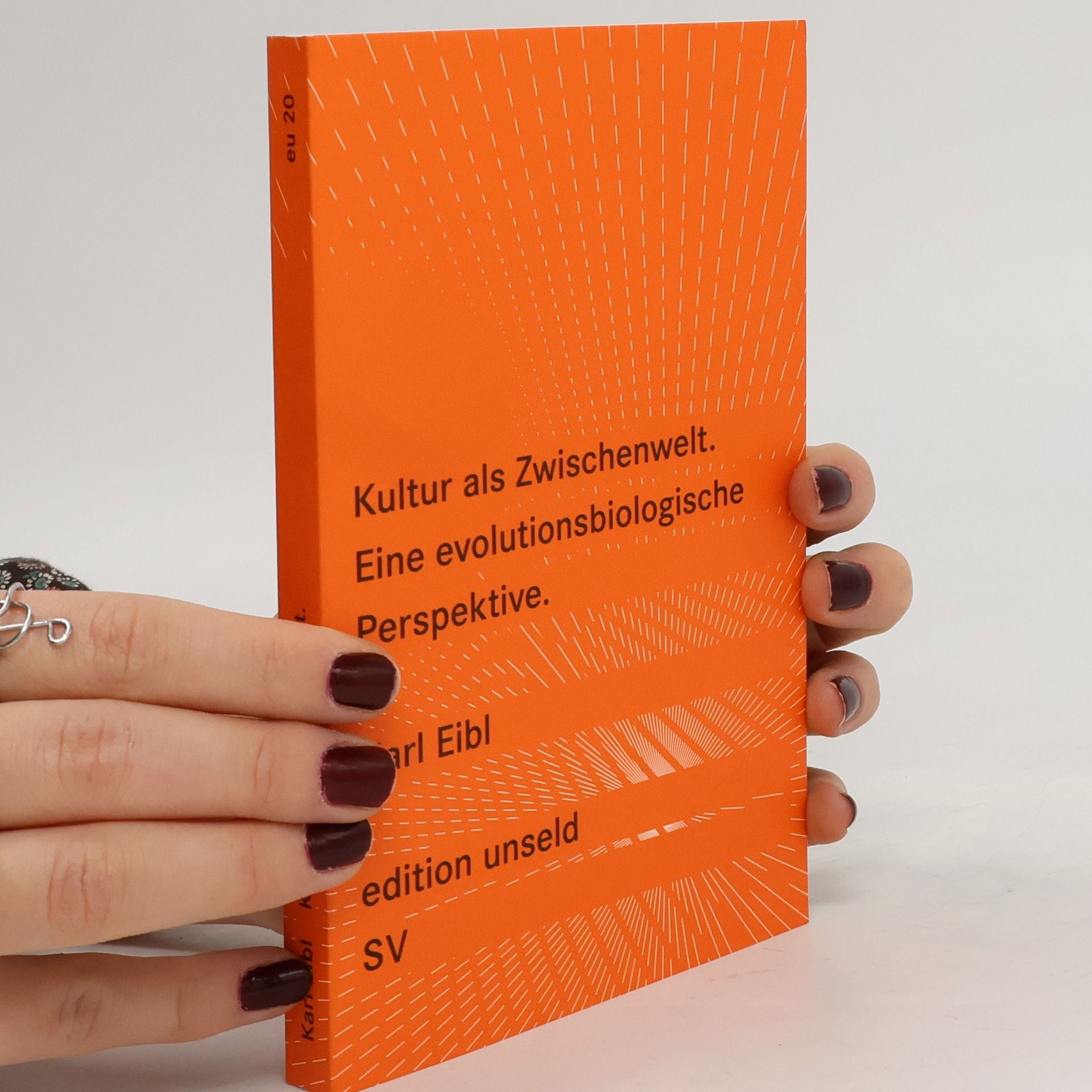Kein ernstzunehmender Anhänger der biologischen Perspektive wird die Bedeutung der Kultur für das menschliche Verhalten leugnen, und umgekehrt wird kein Anhänger der kulturwissenschaftlichen Perspektive die Rolle der Evolution in diesem Kontext bestreiten. Beide Seiten tendieren jedoch dazu, die Bedeutung der jeweils anderen zu bagatellisieren, um sich auf ihre eigene Sichtweise zu konzentrieren. Karl Eibl sieht die menschliche Kulturfähigkeit nicht als Gegensatz zur biologischen Ausstattung, sondern als Produkt der biologischen Evolution. Die Vergegenständlichungsfunktion der Menschensprache ermöglicht es, auf Abwesendes zu referieren, und erlaubt die Gestaltung kohärenter eigener Welten – den Zwischenwelten. Kulturen fungieren als relativ autonome Relaisanlagen, die die sich wandelnde Umwelt des Menschen auf sein in Jahrmillionen evolviertes Nervensystem abstimmen. Das Buch erläutert die biologischen Bedingungen und kulturellen Mechanismen dieser Konstruktionen und beleuchtet die biologischen Grundlagen hochkultureller Phänomene wie Religion, Philosophie und Kunst. Die Fähigkeit des Entkoppelns ist entscheidend für die menschliche Problemlösung, da sie es ermöglicht, große Informationsmengen zu verwalten, ohne dass diese direkt das Handeln beeinflussen. Informationen können mit Hinweisen versehen werden, die ihre Gültigkeit und Relevanz kennzeichnen.
Karl Eibl Libros