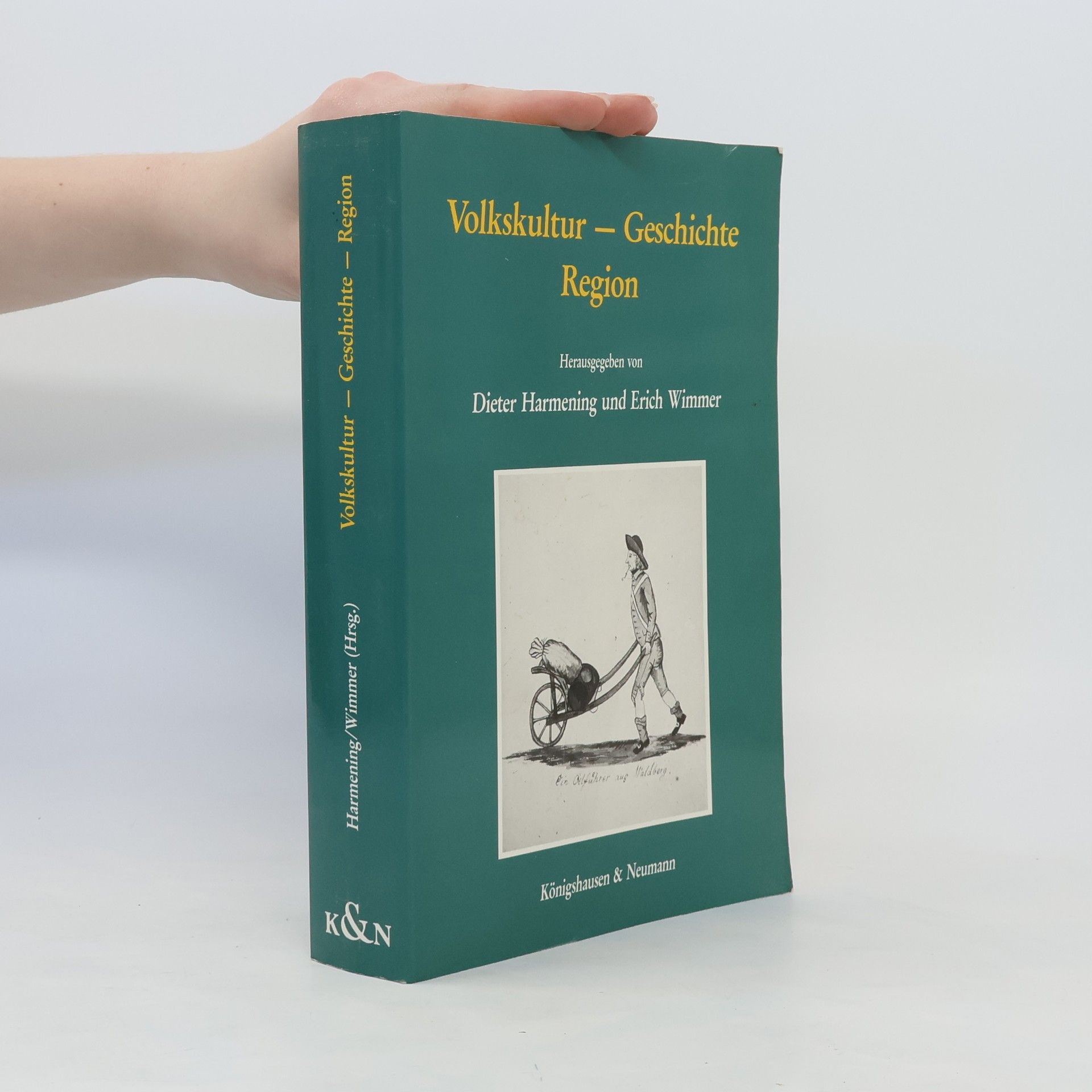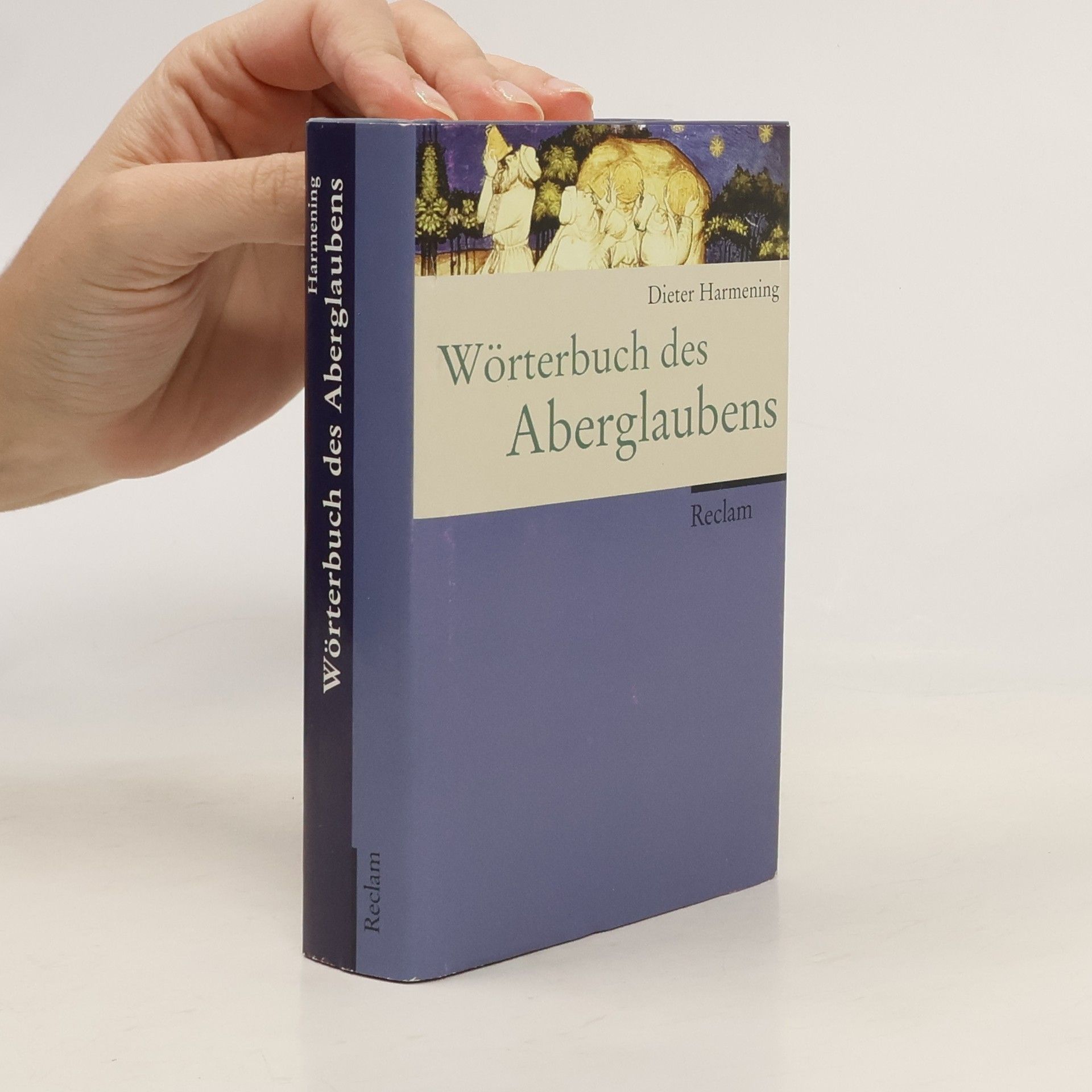Wörterbuch des Aberglaubens
- 520 páginas
- 19 horas de lectura
In über 1000 Stichworten wird die Welt des Aberglaubens erstmals in Anbindung an die neuere Forschung umfassend dargestellt. Von einem kultur- und religionswissenschaftlich fundierten Aberglaubensbegriff ausgehend legt das Lexikon großen Wert auf quellenkritischen Umgang mit den Belegen und auf eine weder unkritische noch verdammende Haltung zu Magie und Geisterglauben.