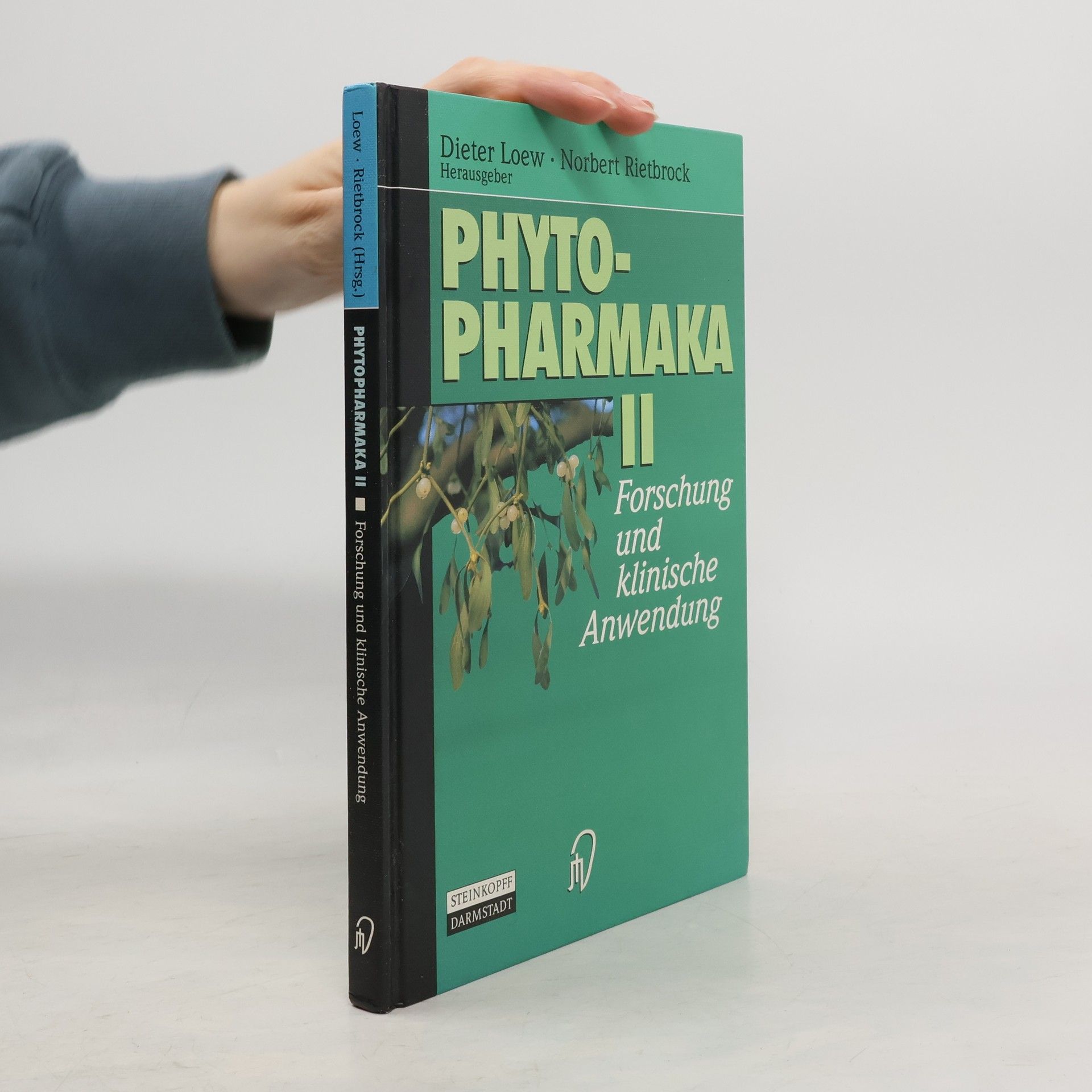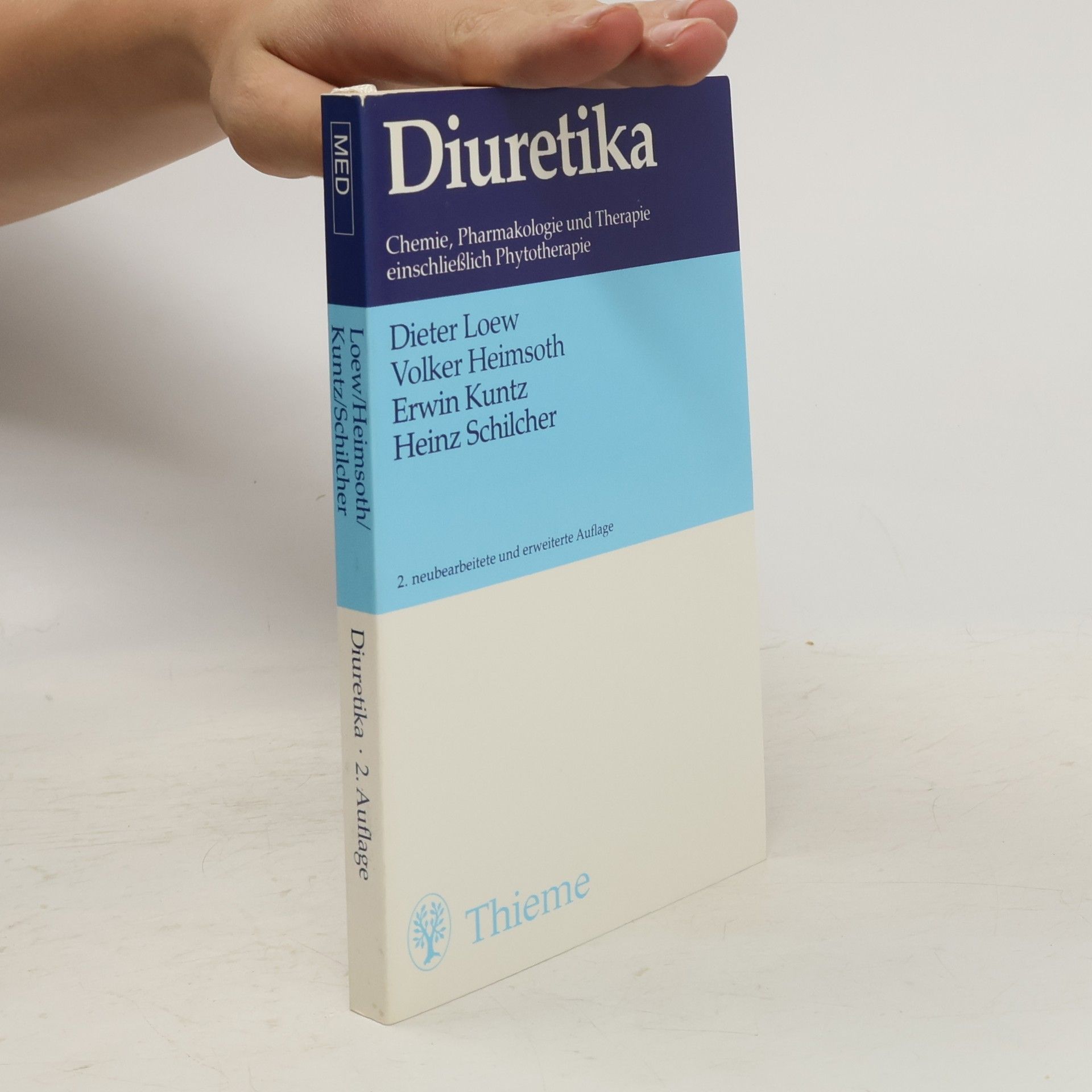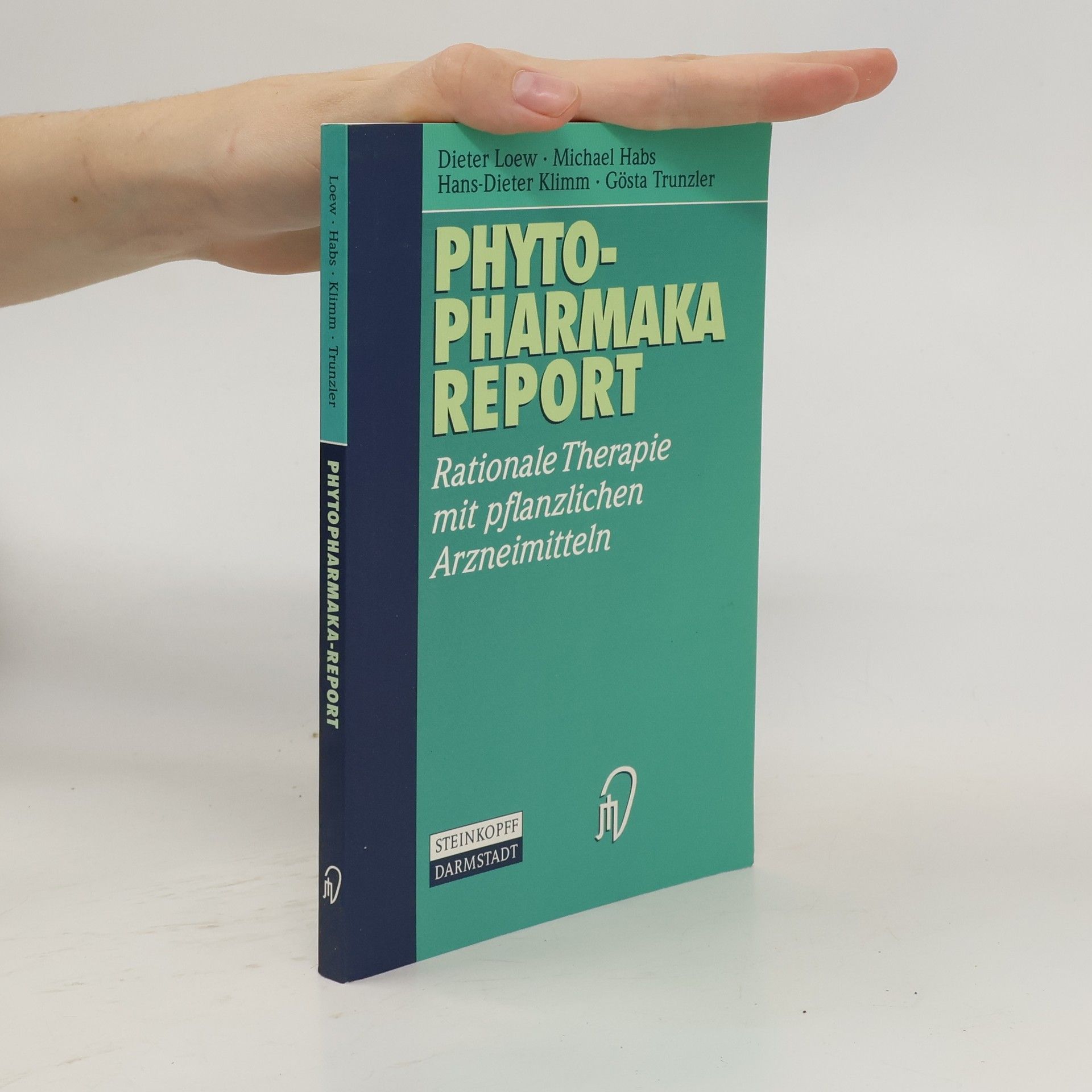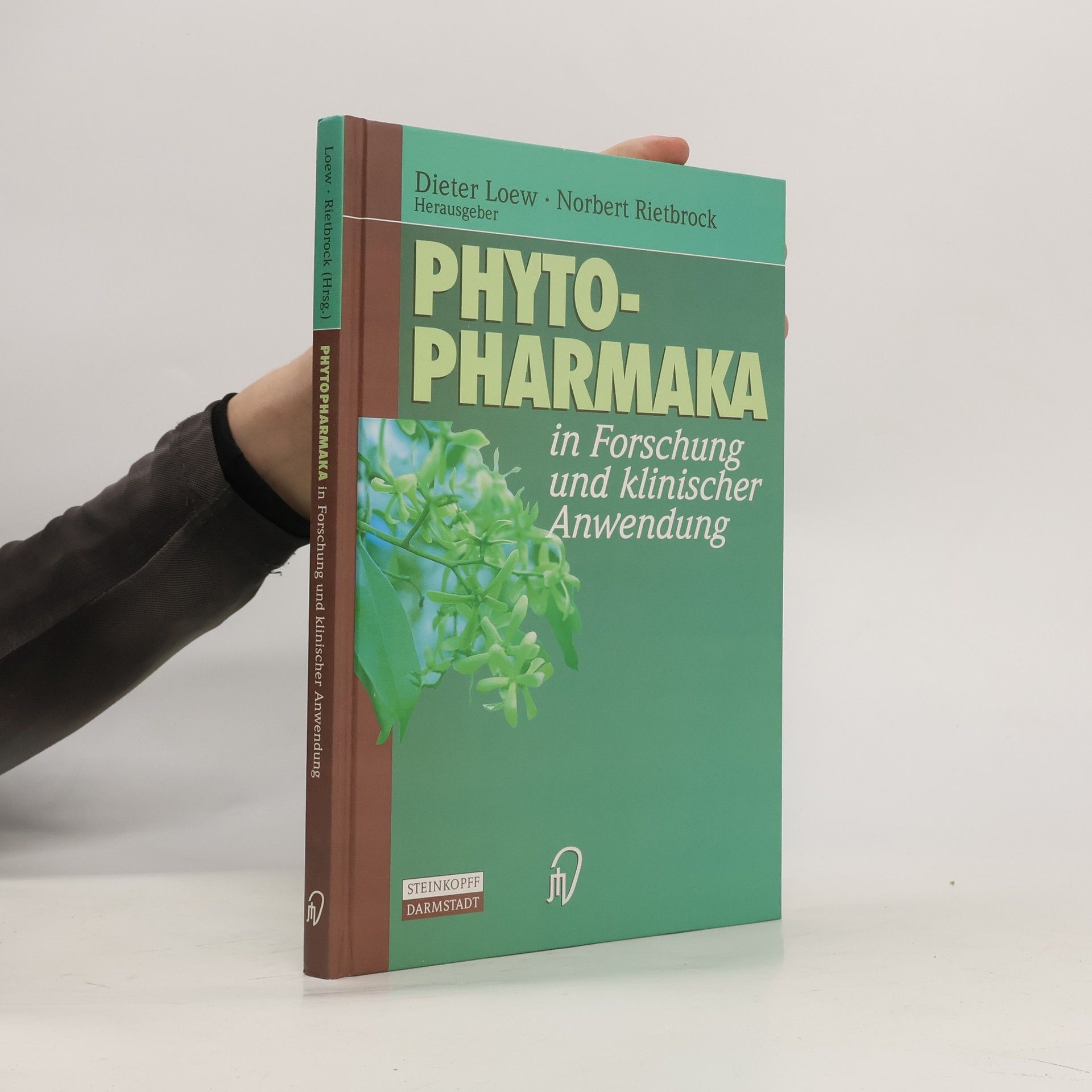Phytopharmaka in Forschung und klinischer Anwendung
- 189 páginas
- 7 horas de lectura
Unter Phytotherapie versteht man die Behandlung mit Pflanzenteilen und deren Zubereitungen. Phytopharmaka sind Mehrfach- oder Vielfachstoffgemische, die in ihrer Gesamtheit oder als Einzelkomponente zur Wirksamkeit beitragen kAnnen. QualitAt, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit sind Voraussetzung fA1/4r die Anwendung am Menschen. Sie unterliegen den gleichen wissenschaftlichen Anforderungen, wie sie an chemisch-synthetische Arzneimittel gestellt werden.