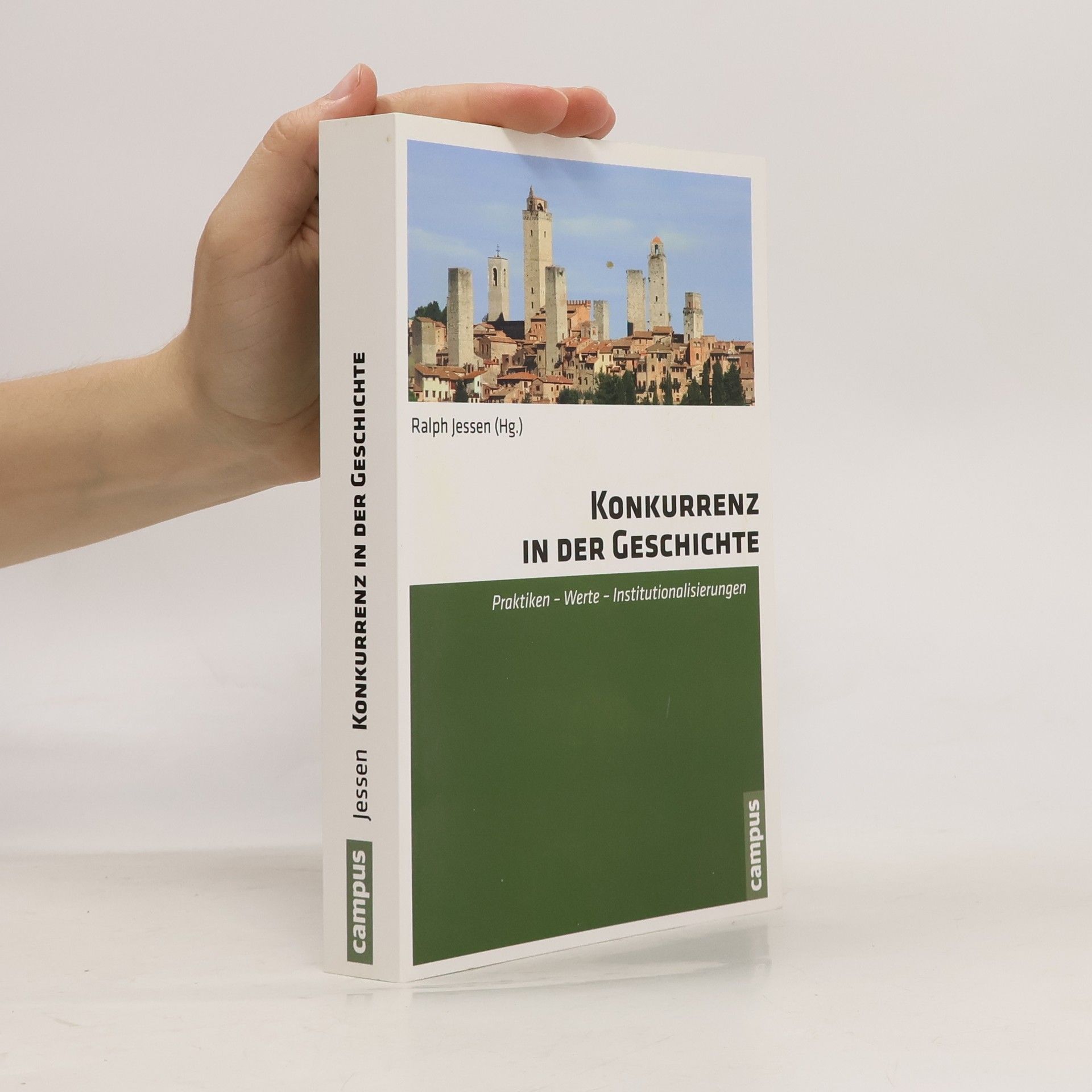Konkurrenz in der Geschichte
Praktiken - Werte - Institutionalisierungen
- 384 páginas
- 14 horas de lectura
Anders als es ein verbreiteter wirtschaftswissenschaftlicher Modellplatonismus behauptet, ist »Konkurrenz« kein naturwüchsiger Ausdruck individueller Nutzenmaximierung. Wie Menschen um knappe Güter konkurrieren – sei es Geld, Macht, Prestige oder auch die Anerkennung wissenschaftlicher Wahrheiten – und ob dieser Wettbewerb als fair und legitim akzeptiert wird, hängt vielmehr von vielfältigen kulturellen Voraussetzungen, institutionellen Arrangements und sozialen Praktiken ab. An ausgewählten Beispielen der europäischen Geschichte untersuchen die Autoren den Wandel der Praxis, der Rechtfertigung und der sozialen Wirkung von Konkurrenz und Wettbewerb; sie geben der Gegenwartskontroverse um die Entfesselung der Konkurrenz in der globalisierten Welt damit die nötige historische Tiefendimension.