Was löst ein gutes Gespräch aus? Der NZZ-Feuilletonchef René Scheu führt regelmässig Interviews mit grossen Persönlichkeiten zu Fragen über Kultur, Politik und Gesellschaft. Für Scheu stellt der Dialog ein Gegengewicht zur Social-Media-Beliebigkeit dar.Alle schreien, viele schweigen, die wenigsten sprechen noch miteinander. Das ist der Befund, der für das Zeitalter der sozialen Medien gilt. Doch gerade im digitalen Zeitalter sind Gespräche notwendiger denn je. Sie finden von Angesicht zu Angesicht statt, in der Präsenz zweier Menschen, zu einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Raum, hier und jetzt. Im Gespräch entwickelt sich zwischen zwei Menschen eine intellektuelle Intensität und Dynamik, die über das bisher von ihnen Gedachte und Gewusste hinausweist. Was so entsteht, ist für sie - und für die Leser - ein Denk- und Sprachabenteuer, im besten Fall schaffen sie etwas Neues. René Scheu präsentiert im Band seine besten Gespräche mit unterschiedlichen Protagonisten des Zeitgeschehens, Stanford-Professor Hans Ulrich Gumbrecht beleuchtet in einem Essay die Bedeutung des Gesprächs als literarische Form.Gespräche mit Peter Sloterdijk, Niall Ferguson, Peter Thiel, Wolfgang Beltracchi, Francis Fukuyama, Mary Rorty, Condoleezza Rice, Peter Handke, Jonathan Franzen, Steven Pinker, Rüdiger Safranski, Jörg Baberowski, Daniel Kehlmann, Robert Harrison, Slavoj Zizek, Mario Vargas Llosa.
Rene Scheu Libros

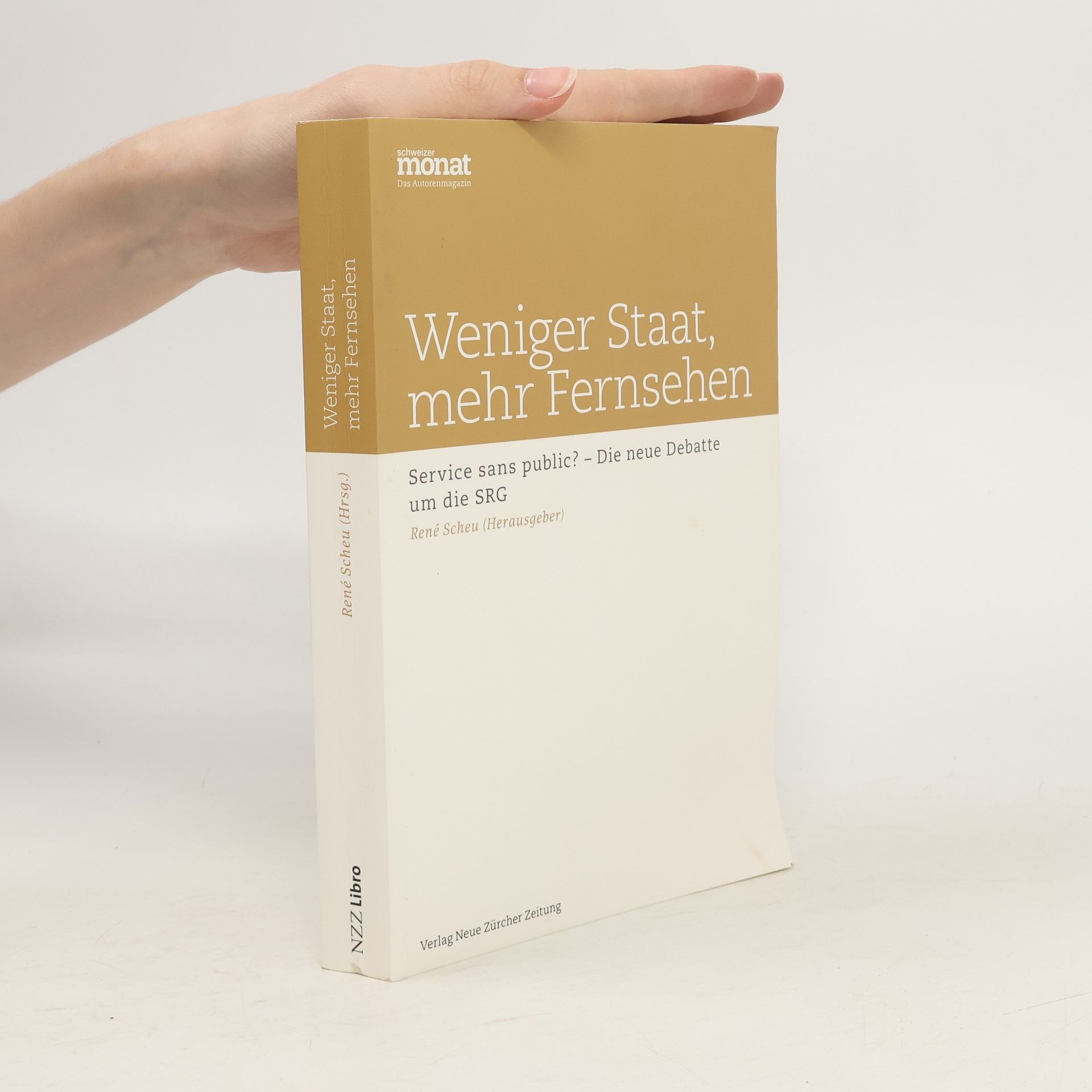


Gespräch und Gestalt
Entspannte Interviews mit Ayaan Hirsi Ali, Maxim Biller, Jörg Baberowski, Klaus Doldinger, Woody Harrelson, Ilana Lewitan, Elif Shafak, Peter Sloterdijk, Oliver Stone, Anna Zeiter, Slavoj Žižek und anderen
Im Zeitalter der schrillen Identitäts-Forderungen und überzeichneten Selbstbilder in den sozialen Medien ist Individualität fluide geworden. Sie zeigt sich nicht mehr im Beharren auf den immer gleichen stereotypen Merkmalen, sondern in der gelassenen Fähigkeit, etwas aus den Zufällen menschlicher Begegnungen zu machen. Es gilt die Devise: Wenn zwei aufeinandertreffen, ist immer alles möglich. René Scheu pflegt die journalistische Technik des Interviews als Rahmen, in dem sich diese neue Kraft des Individuellen entfalten kann. Sein Fragen und sein Zuhören geben ganz unterschiedlichen Zeitgenossen eine erkennbare Gestalt im anhaltenden Kommunikationsfluss und zugleich die Gelegenheit, sich selbst anders und neu kennenzulernen. René Scheu im Gespräch mit: Ayaan Hirsi Ali, Maxim Biller, Jörg Baberowski, Klaus Doldinger, Woody Harrelson, Ilana Lewitan, Peter Sloterdijk, Oliver Stone, Slavoj Žižek und anderen. Mit einem Essay von Hans Ulrich Gumbrecht.
Beiträge zur Debatte um die Radio- und TV-gebühren und darum, wie viel Einfluss der Staat auf die Strategie des Schweizer Radio und Fernsehens nehmen soll. Warum sollen selbst jene Leute, welche die Programme der SRG weder konsumieren wollen noch konsumieren können, zur Kasse gebeten werden? Ist die Unterhaltung wirklich Sache des Staates? Befördert die SRG tatsächlich den «nationalen Zusammenhalt»? Müssen dem Bundesrat unbedingt vor jeder Abstimmung vier Sendeminuten eingeräumt werden? Und würde die erste Marslandung wohl im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt? 17 Beiträge gehen diesen und weiteren Fragen kritisch nach. Mit Beiträgen von: René Scheu, Karl Lüönd, Gerhard Pfister, Claudia Wirz, Denise Bucher, Ronnie Grob, Rico Bandle, Benedict Neff, Pietro Supino, Kurt W. Zimmermann, Dominik Kaiser und Florian Oegerli, Ralf Dewenter, Pierre Bessard, Hans-Ulrich Bigler, Brenda Mäder und Simon Scherrer, Selina Hofstetter, Michelle Inauen.
Das schwache Subjekt
- 333 páginas
- 12 horas de lectura
Mit dieser Arbeit legt René Scheu die erste umfassende Darstellung des Denkens von Pier Aldo Rovatti vor. Zusammen mit Gianni Vattimo hat Rovatti 1983 in Italien den Sammelband 'Das schwache Denken' (Il pensiero debole) publiziert, der zu einem Grundlagenwerk der zeitgenössischen Philosophie wurde. Sein Denken nimmt Ausgang von einer Neudeutung der Husserlschen Epoché und mündet in die Schwächung eines starken, in der Philosophie bis heute vorherrschenden Subjektbegriffs. Neben neuen Einsichten in die Frage nach der Konstitution des konkreten, 'leibhaften Subjekts' (soggetto in carne ed ossa) eröffnen Rovattis Überlegungen auch interessante philosophiegeschichtliche Perspektiven. Er zeigt auf, warum Husserls Projekt einer strengen Wissenschaft zum Scheitern verurteilt war und im Scheitern ein paradoxes Subjekt zum Vorschein brachte, das noch zu denken bleibt. Neues Licht auf die Heidegger-Rezeption wirft auch seine These, die berühmte Kehre erweise sich letztlich als Zukehr zur phänomenologischen Frage nach der Erfahrung eines schweigend-hörend-sprechend-sehenden Subjekts, das sich anthropologisch nicht fassen lässt. Bei aller Präzision in der Sache bleiben Rovattis Analysen nie abstrakt, sondern müssen sich in bester phänomenologischer Manier an der subjektiven Erfahrung des Spiels und des Wahnsinns bewähren.