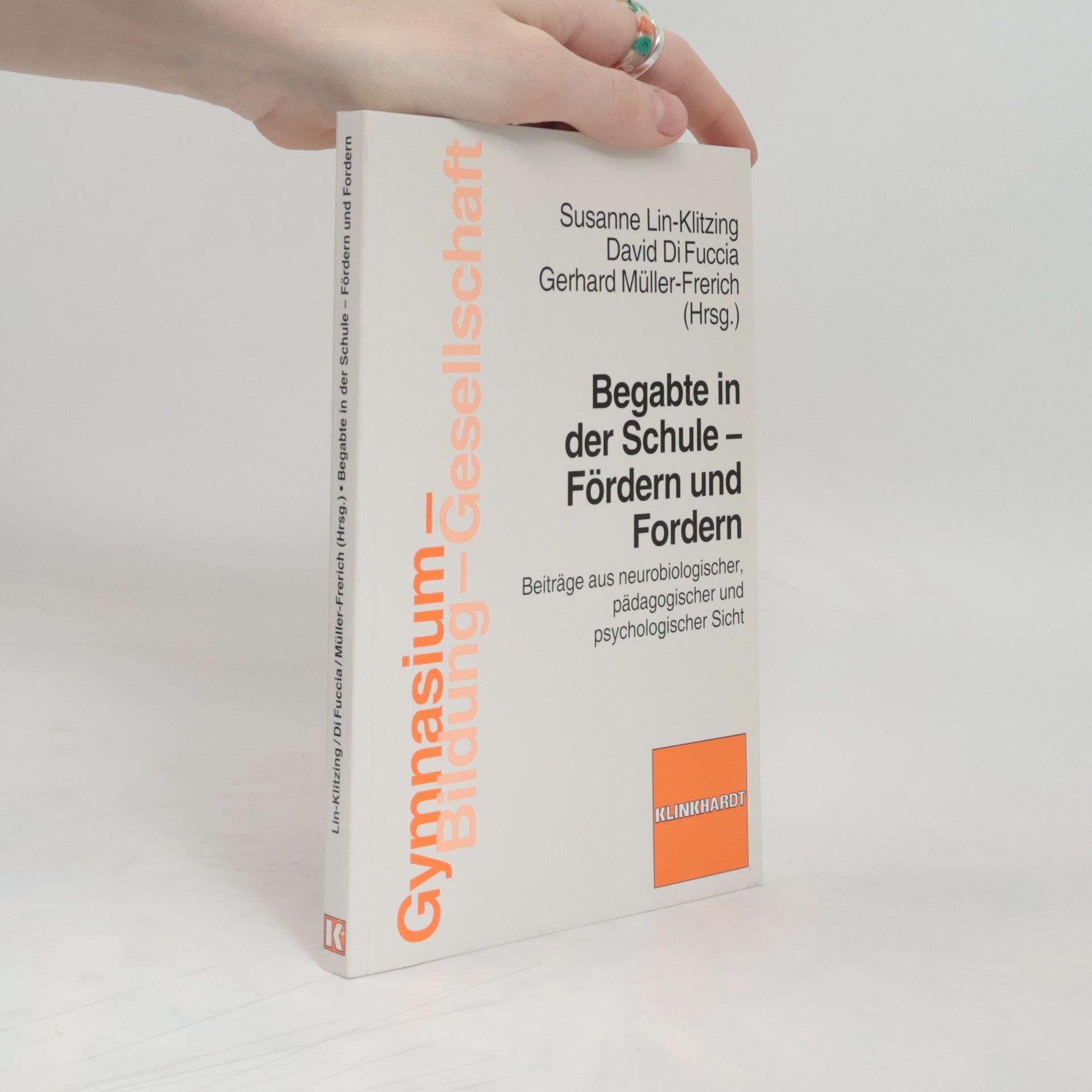Gibt es neue neurobiologische Annahmen über das Lehren und Lernen in der Schule – und wenn ja, welche? Inwiefern können Strategien selbst regulierten Lernens insbesondere für begabte und hochbegabte Schülerinnen und Schüler fruchtbar gemacht werden? Wie werden Hochbegabte in der Schule erkannt, welche besonderen Möglichkeiten haben sie, und welchen spezifischen Problemen sind sie ausgesetzt? Diese Fragestellungen zur „schulischen Begabtenförderung“ werden im vorliegenden Band auf verschiedenen Ebenen interdisziplinär von deutschen und österreichischen Wissenschaftlern erörtert. Im Interesse einer breiten wissenschaftlichen Diskussion einer zunehmend notwendiger werdenden Begabtenförderung versammeln die Herausgeber verschiedene Wissenschaftler, die zu Aspekten des Lernens in der Schule aus neurobiologischer Sicht, zur Förderung Begabter in der Schule und zur Frage nach der „Identifikation“ Hochbegabter Stellung nehmen.
Susanne Lin Klitzing Libros