In diesem Band wird der Sachunterricht aus der Perspektive des Lernens und der Lernenden beleuchtet. Erkenntnisse über Lernvoraussetzungen für den Sachunterricht und lerntheoretische Ansätze sowie die konzeptionellen Konsequenzen für einen lernförderlichen Sachunterricht stehen hier im Zentrum der Analyse.
Detlef Pech Libros
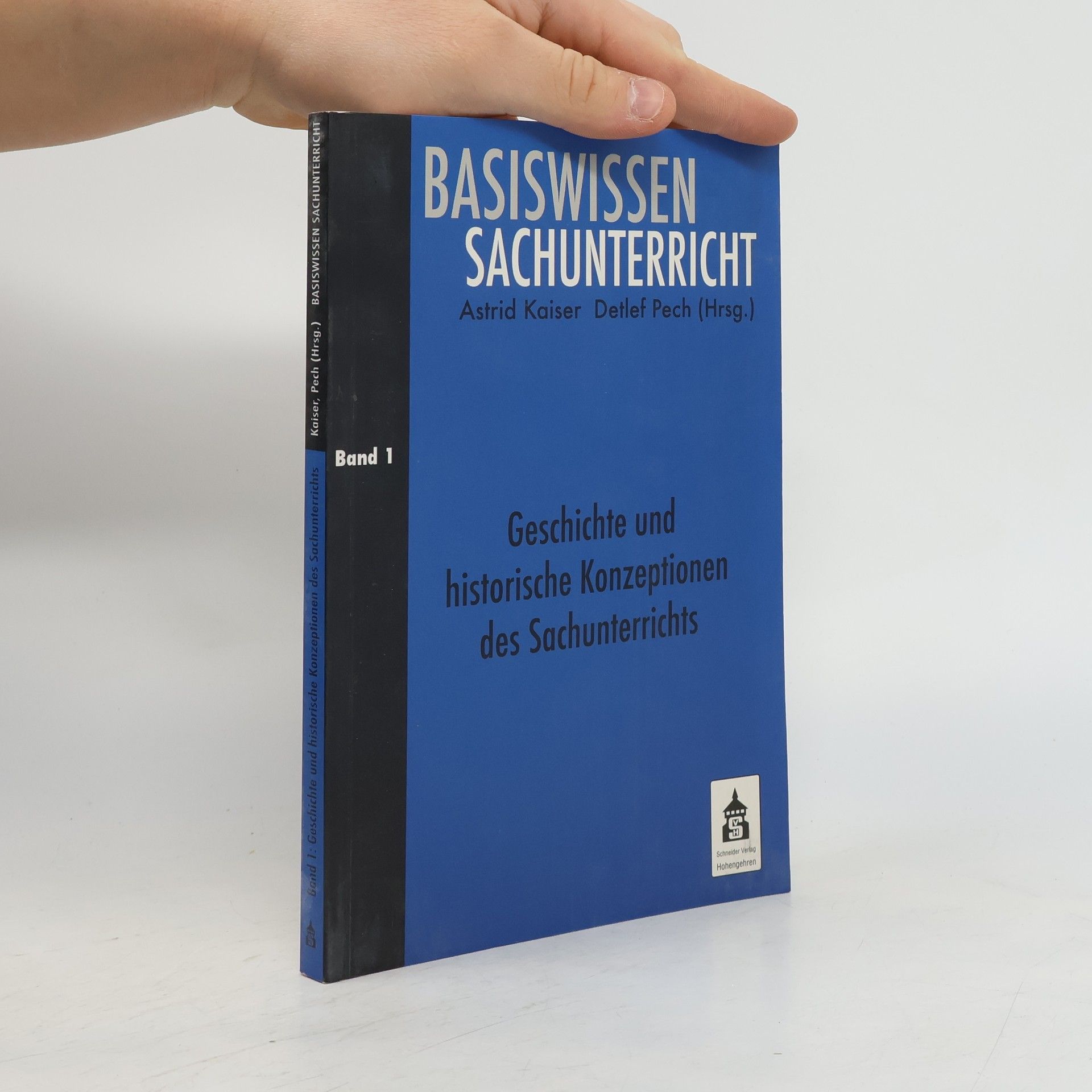
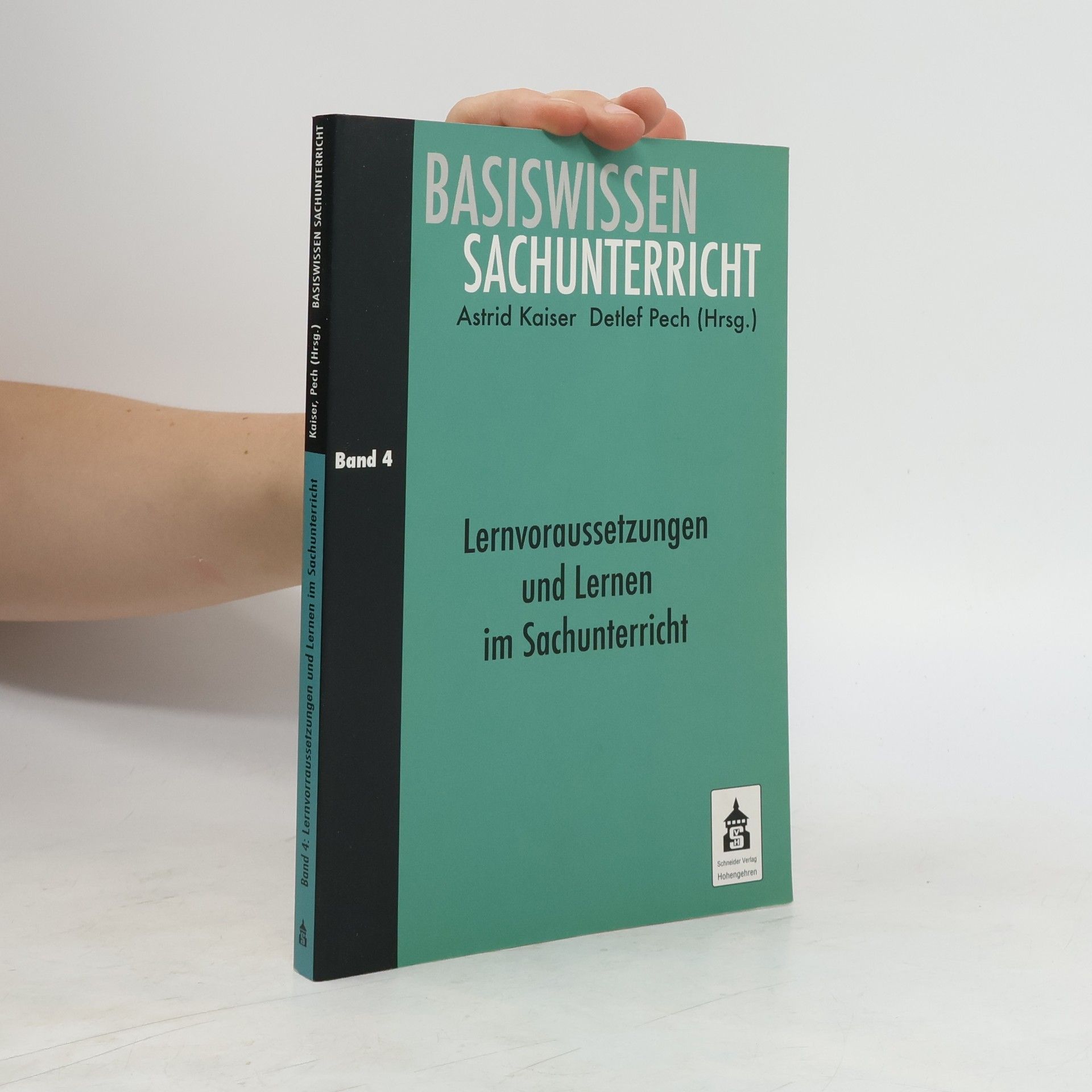
Basiswissen Sachunterricht. Band 1
Gesichichte und Historische Konzeptionen des Sachunterrichts