Das Periodikum IMAGO wurde mit dem Ziel gegründet, Diskussionen zwischen Kunst, Ästhetik, Psychoanalyse und angrenzenden Disziplinen anzustoßen und zu intensivieren. Das Jahrbuch versammelt interdisziplinär orientierte Beiträge, die sowohl grundsätzliche theoretische Fragen behandeln als auch Deutungen empirischen Materials liefern.Das weitgefächerte Themenspektrum des dritten Bandes reicht von Gewalt und Gelächter in der Literatur des Mittelalters über die Ozeanische Entgrenzung in den Künsten und das Verhältnis von Kunst und Lebenswelt bis zu Fantasie und Wahrnehmung im Spiegel neuer Kino-Technologien.Mit Beiträgen von Barbara Borg, Martin Büchsel, Manfred Clemenz, Markus Dauss, Martin Gessmann, Carola Hilmes, Sebastian Leikert, Marc Ries, Werner Röcke, Kerstin Thomas, Christiane Voss und Hans Zitko
Markus Dauss Libros

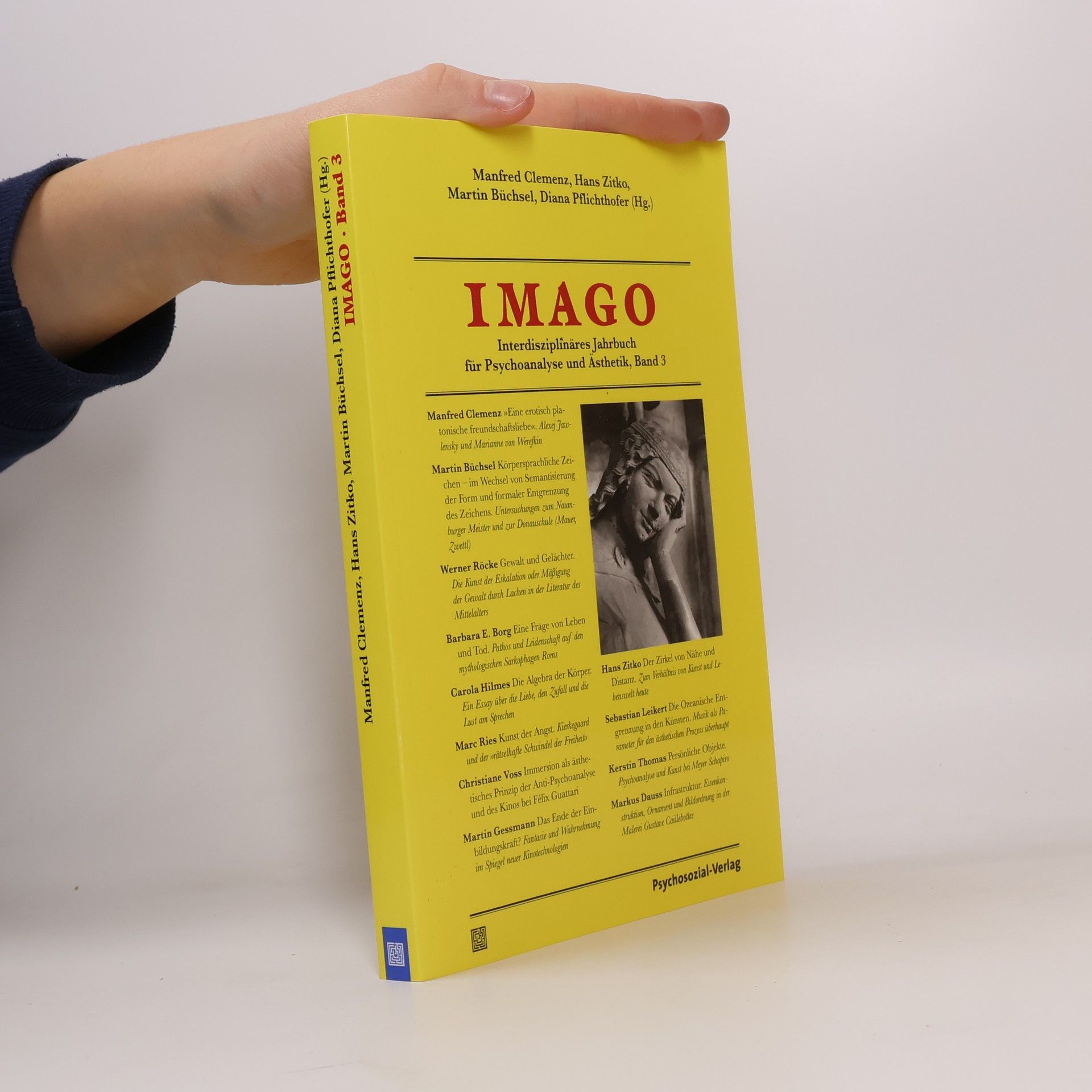
Der Mensch lebt in Räumen - von den Höhlen der Steinzeit über gebaute Architekturen bis hin zu digitalen Welten der Gegenwart. Räume sind Ausdruck sozialen und kulturellen Wandels. Hierbei entstehen Zustände eines Dazwischen-Seins. Wie und wo manifestieren sich diese im architektonischen Raum? Wie gehen Menschen mit den Zwischenräumen um, in denen sie sich befinden? Thematisiert werden u.a. Strategien nigerianischer Migrantinnen auf dem Weg nach Europa, Raumstrukturen in englischen Pfarrkirchen im 15. und 16. Jahrhundert und das Suburbane in Werken Camille Pissarros.Aus dem Inhalt:- Nigerianische Migrantinnen auf dem Weg nach Europa- Der Hafen als Topos in der gemalten Kunsttheorie des 17. Jahrhunderts in den Niederlanden- Otto Dix' politische Landschaftsgemälde 1933 bis 1945- Steinerne Landschaften in der Cassone- und Spallieramalerei des Florentiner Quattrocento- Digitales Spielen als Bildoperation im Zwischenraum- Raumstrukturen in Pfarrkirchen des südöstlichen England im 15. und 16. Jahrhundert- Die Deutungsoffenheit religiöser Repräsentationsräume- Impressionen des Suburbanen bei Camille Pissarro- Stadtquartiere im Umbruch am Beispiel des Berliner Bezirks Marzahn-Hellersdorf- Urban Hacking: Die Konfliktmetaphorik eines virtuell-realen Zwischenraums Jetzt reinlesen: Inhaltsverzeichnis(pdf)