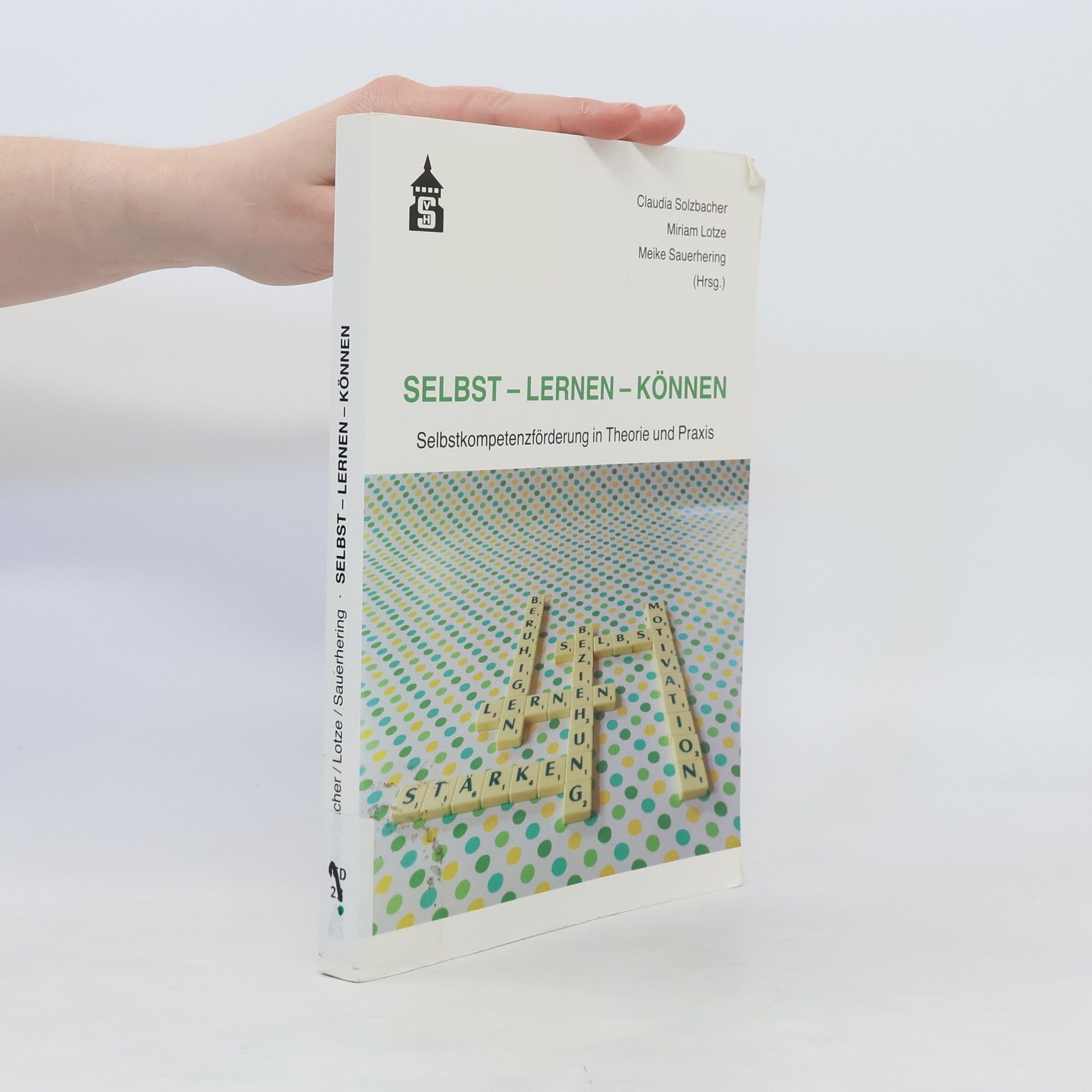Selbstkompetenz als Basiskompetenz für Lernen ist ein zentrales, aber eher vernachlässigtes Thema in der (Schul-)Pädagogik. Die Förderung von Persönlichkeitseigenschaften wie sich selbst zu beruhigen, sich selbst zu motivieren, Frustrationstoleranz entwickeln zu können sowie zielgerichtet zu planen und diese Pläne auch in Handeln umsetzen zu können, ist unabdingbar, wenn Lernen gelingen soll. Die Grundlagen für diese Fähigkeiten werden in der frühen Kindheit gelegt, können aber in der gesamten (Bildungs-)Biographie entwickelt und verfestigt werden und sind somit integraler Bestandteil der pädagogischen Arbeit. In diesem Band werden sowohl theoretische Grundlagen zum Thema Selbstkompetenzentwicklung und Selbstkompetenzförderung als auch praxisnahe Ansätze für Schule und darüber hinaus dargestellt.
Claudia Solzbacher Libros