Hass-Postings kennt jeder – und viele denken dabei nur an Hasskommentare. Daniel Hornuff aber zeigt: Wer die Bilder übersieht, die zusammen mit den Texten in Umlauf gebracht werden, unterschätzt die Gefahr, die vom Hass in den Sozialen Medien ausgeht.Kann man von einer Ästhetik des Hasses in den Sozialen Medien sprechen? Wie entstehen Radikalisierungen, wie verhärten sich Ressentiments? Hornuff macht deutlich, dass Hass nicht nur sprachlich entfaltet wird: Es sind Bilder, die ihn ästhetisch auffächern und anschlussfähig werden lassen.So deutet Daniel Hornuff den Hass in den Sozialen Medien nicht als psychische Regung, sondern als kommunikativen Akt. Und er weist darauf hin: Niemand muss diesem Phänomen machtlos gegenüberstehen!
Daniel Hornuff Libros
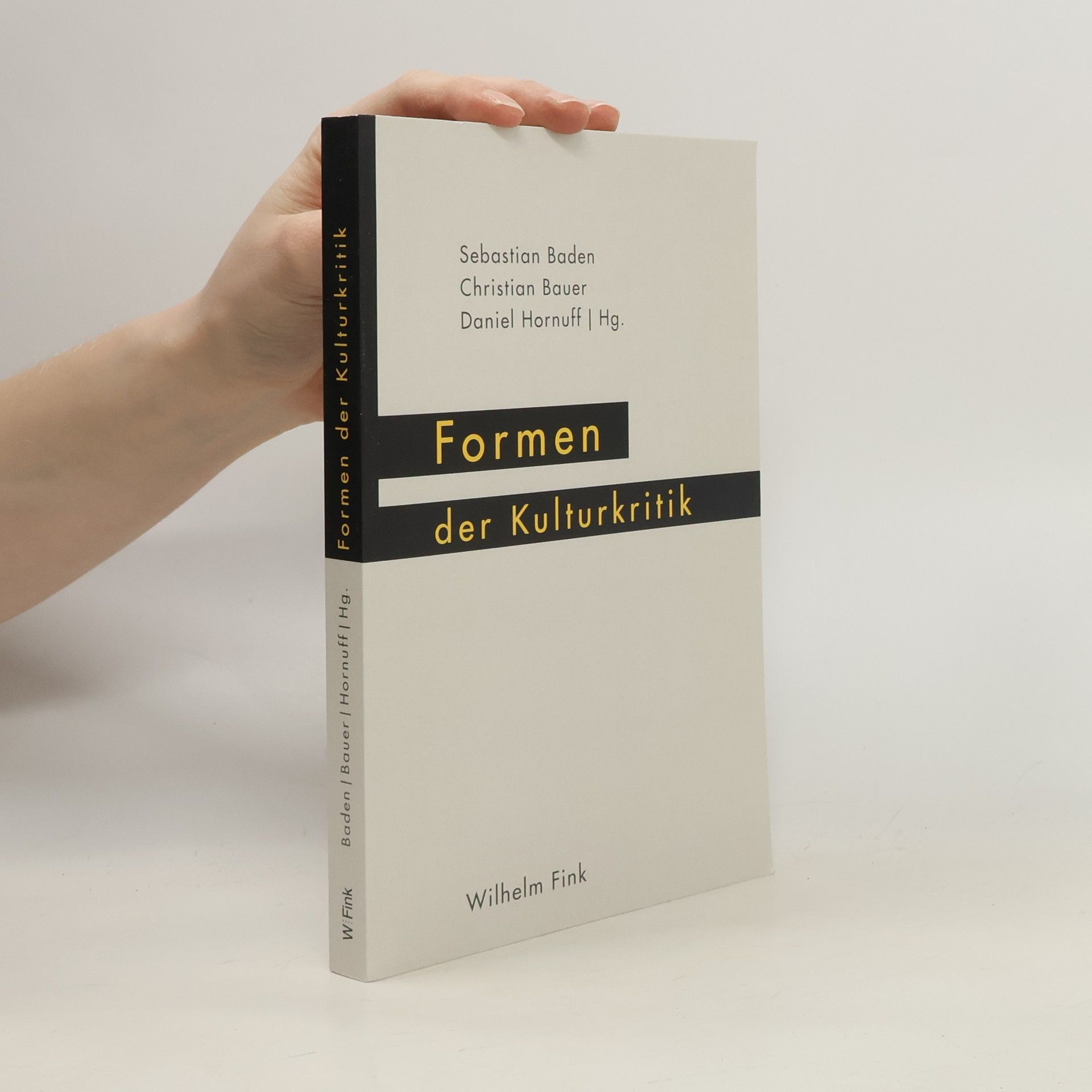



Krass! Beauty-OPs und Soziale Medien
- 146 páginas
- 6 horas de lectura
Beauty-OPs boomen. Weltweit. Und dies nicht zuletzt durch den Aufstieg der Sozialen Medien. Instagram, Facebook und YouTube haben die Körperkultur grundlegend verändert. Heute präsentieren sich Millionen Menschen in Bildern, und ebenso viele betrachten und bewerten diese Bilder. Entsprechend groß ist das Bedürfnis, den Körper ästhetisch zu optimieren, ihn als „krasses“ Ereignis in Szene zu setzen. Vor dem Auftritt im Bild steht daher zunehmend die Arbeit am eigenen Fleisch. Zentral ist die Frage der Gestaltung: Welche Schönheitsnormen werden aufgebaut? Welche verworfen? Wie ist zu erklären, dass solche Operationen einerseits florieren – es andererseits aber noch immer einem Outing gleicht, sich zu ihnen zu bekennen? Welche Vorstellungen von Öffentlichkeit und Intimität, von Geschlecht und Sexualität, von Kultur und Natur werden dabei verhandelt? Ein Essay über die Frage, wie tief das Design in Körper eingreift – und wie sich das Label „krass“ zu einer neuen ästhetischen Kategorie entwickeln konnte.
Keine Kompromisse?
Wilhelm Wagenfeld und der Nationalsozialismus
Formen der Kulturkritik
- 238 páginas
- 9 horas de lectura
Klagen über den Verfall der Kultur gehören zu den beliebtesten Übungen von Intellektuellen. In welchen Formen sich diese Klagen äußern, untersuchen Beiträge namhafter Wissenschaftler. Viele empfinden die Gegenwart als zu hektisch, zu laut, zu oberflächlich, zu chaotisch. Doch diese Diagnosen unter dem Vorzeichen von Kulturkritik sind so alt wie die Moderne selbst. Was sich allerdings wandelt, sind die Medien von Klagen über Entfremdung und die Inszenierungen des Niedergangs. Der Band nimmt diese Klagetradition zum Anlass, um die Modalitäten von Kulturkritik näher zu beleuchten: In welchen Rede- und Schreibweisen, Erscheinungsbildern, Zeichen- und Ausdruckswelten nehmen kulturkritische Leidensemphasen Gestalt an? Und wie konsumieren zeitgenössische Rezipienten die alltäglichen Angebote der Kulturkritik?