Ressourcen aktivieren
Ein Ratgeber für mehr Wohlbefinden und Resilienz
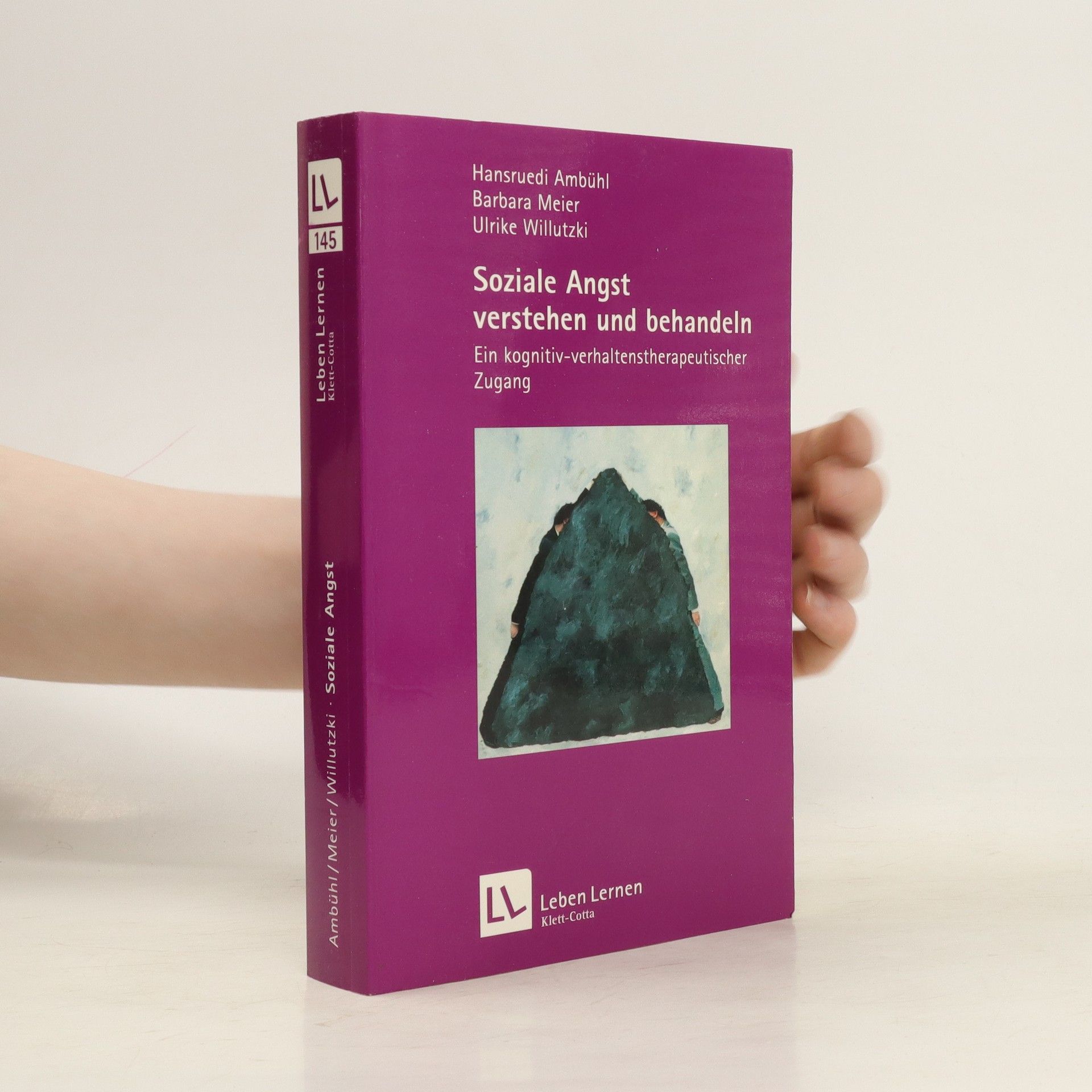


Ein Ratgeber für mehr Wohlbefinden und Resilienz
Ein Kompass für die Ausbildungs- und Berufspraxis
Systemische Therapie hat sich in den letzten Jahren im Versorgungssystem etabliert. Dieses Kompendium behandelt praktische Fragen zur Integration von Psychotherapierichtlinien und systemischem Denken. Es beleuchtet das Verhältnis zwischen psychiatrischen Diagnosesystemen und dem systemischen Verständnis von Problemen. Zudem wird erörtert, wie der systemische Ansatz bereits in den ersten Patient:innenkontakten berücksichtigt werden kann und wie Fallkonzepte entwickelt werden können, die die Komplexität und Selbstorganisation von Patient:innensystemen anerkennen. Die bereitgestellten (Online-)Materialien und Anregungen unterstützen das Lernen und Lehren systemischer Therapie. Dieses Grundlagen- und Arbeitsbuch dient als Kompass für Aus- und Weiterbildungskandidat:innen, um mit ihrem systemischen Denken durch die Richtlinienpsychotherapie zu navigieren. Es bietet auch erfahrenen Kolleg:innen, die in Ausbildung, Weiterbildung, Lehre und Supervision tätig sind, wertvolle Materialien für die Ambulanz und die Lehre. Zu den behandelten Fragen gehören, wie systemische Praxis den Anforderungen der Richtlinienpsychotherapie gerecht werden kann, und wie maßgeschneiderte Fragebögen in den ersten Kontakten eingesetzt werden können. Des Weiteren wird thematisiert, wie angemessene Fallkonzepte und Behandlungspläne entwickelt und umgesetzt werden können.
Schüchternheit und Gehemmtheit im Umgang mit anderen, geringes Selbstwertgefühl und mangelnde Durchsetzungsfähigkeit schränken die Lebensqualität stark ein. Sozial ängstliche Menschen haben oft Schwierigkeiten, sich im Berufsleben oder in Partnerschaften zu behaupten. Diese Angst kann sich zur sozialen Phobie entwickeln, wodurch der Kontakt zu anderen vermieden wird. Die Verhaltenstherapie bietet bereits erste Ansätze zur Behandlung, die in diesem Werk weiterentwickelt werden. Es werden umfassende Hintergrundinformationen bereitgestellt: Was geschieht bei sozialer Angst? Wie wird Schüchternheit zur Krankheit? Welche Rolle spielen familiäre Häufungen und der Erziehungsstil? Zudem wird untersucht, wie eine soziale Phobie aufrechterhalten wird und wie Angst sich selbst verstärkt. Durch die Analyse individueller angstauslösender Reize und problematischer Überzeugungen können Therapeuten zusammen mit ihren Klienten Ansatzpunkte für Veränderungen finden. Der Fokus liegt auch auf den Ressourcen des Klienten. Ein detailliertes Therapiemanual mit Verlaufsplan unterstützt Verhaltenstherapeuten bei der gezielten Vorgehensweise. Dieses praxisnahe Werk bietet sowohl Therapeuten als auch Betroffenen wertvolle Informationen über die Störung.