Gerhard Göhler Libros

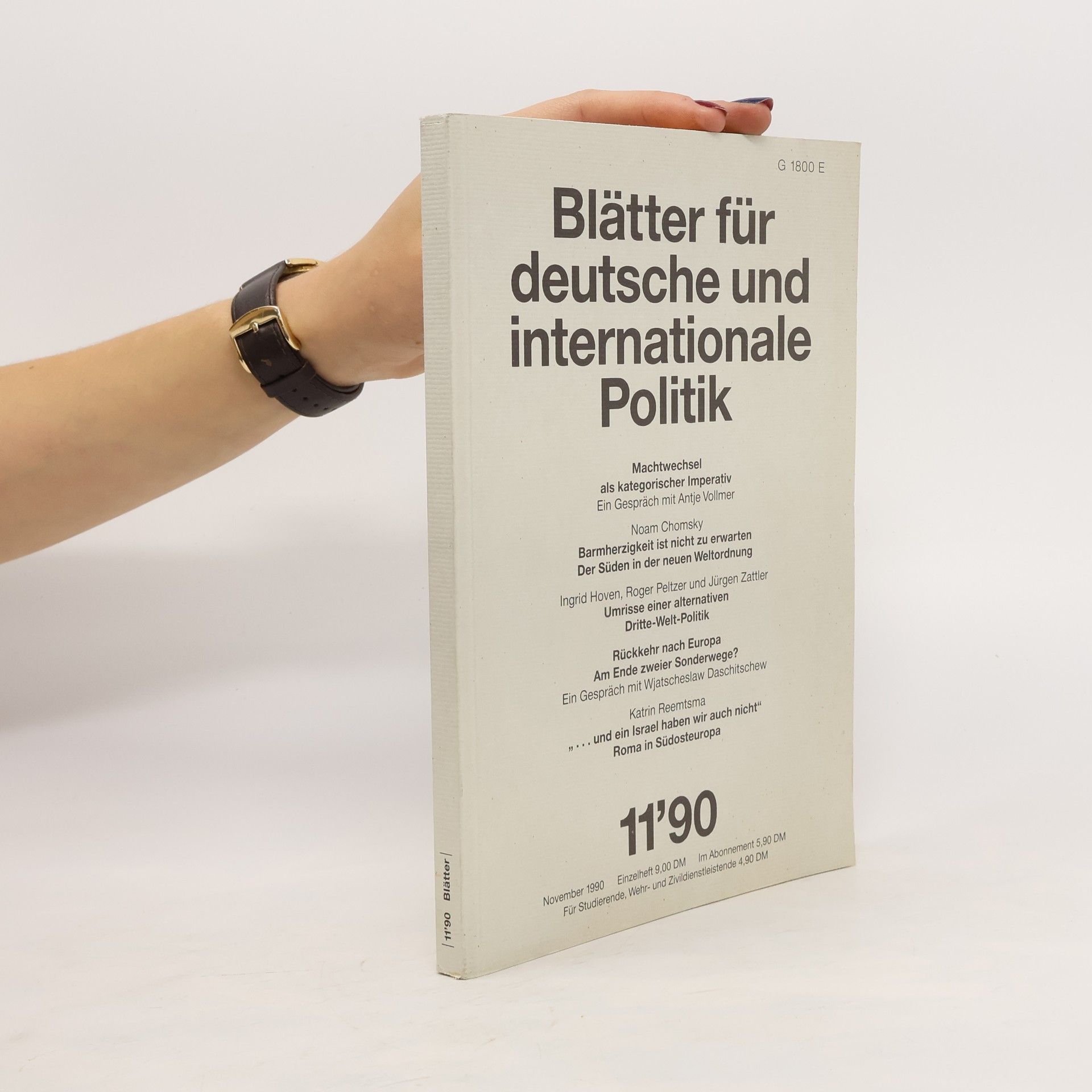

Politische Theorie
25 umkämpfte Begriffe zur Einführung
Was sich hinter Begriffen wie „Demokratie“, „Gerechtigkeit“, „Globalisierung“, „Krieg“ oder „Macht“ verbirgt, ist umstritten - besonders in der politischen Theorie. Anhand von 25 Begriffen, deren Bedeutungsgehalt in den vergangenen zwanzig Jahren besonders stark umkämpft war, führt dieser Band in verständlicher Weise in die wichtigsten Diskussionen und Positionen der politischen Theorie und Philosophie ein. Die Beiträge gliedern sich jeweils in drei Abschnitte: Zunächst verdeutlichen sie die Relevanz des verhandelten Begriffs für die politische Theorie und Philosophie sowie für die politische Praxis. In einem zweiten, besonders ausführlichen Teil werden die Hauptlinien der Auseinandersetzung nachgezeichnet. Drittens stellen die Autorinnen und Autoren eine eigene Position dar. Das Literaturverzeichnis enthält die wichtigsten Lesehinweise.