Was bedeutet Nachhaltigkeit in der Praxis und wie verändert sie unsere Gesellschaft? Es wird viel geredet vom Ende des grenzenlosen Wachstums, von der dringend gebotenen Befreiung vom Wohlstandsballast, von einer Politik der Nachhaltigkeit. Doch was heißt das für die Praxis? Der ehemalige Politiker und Volkswirtschaftler Reinhard Loske verfügt über das theoretische und praktische Wissen, um Anregungen zu geben für ein neues Denken, das sich dem Nachhaltigkeitsideal verpflichtet fühlt und politisch tatsächlich umgesetzt werden kann. Er bespricht anschaulich, welche politischen Reformen notwendig sind. Als sehr wichtig erachtet Loske neue Formen kooperativen Wirtschaftens sowie Verknüpfungen der Ökologiefrage mit Fragen der Freiheit und Gerechtigkeit. »Wir brauchen Zukunftsbilder, um unsere Handlungsspielräume zu kennen. So haben wir die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihres Fachs gebeten, konkrete Utopien zu entwerfen, die uns Mut zum guten Leben machen.« Harald Welzer und Klaus Wiegandt
Reinhard Loske Libros
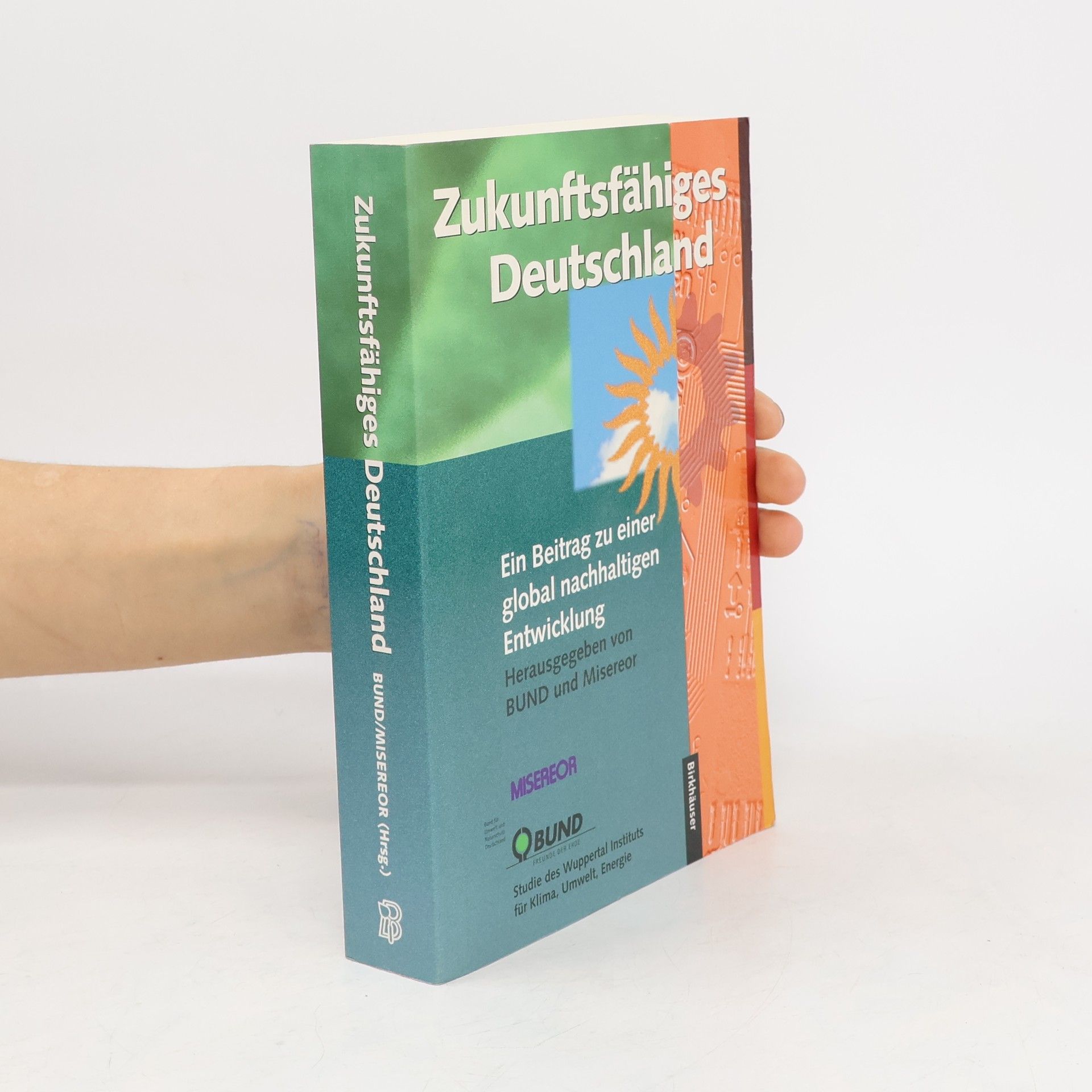
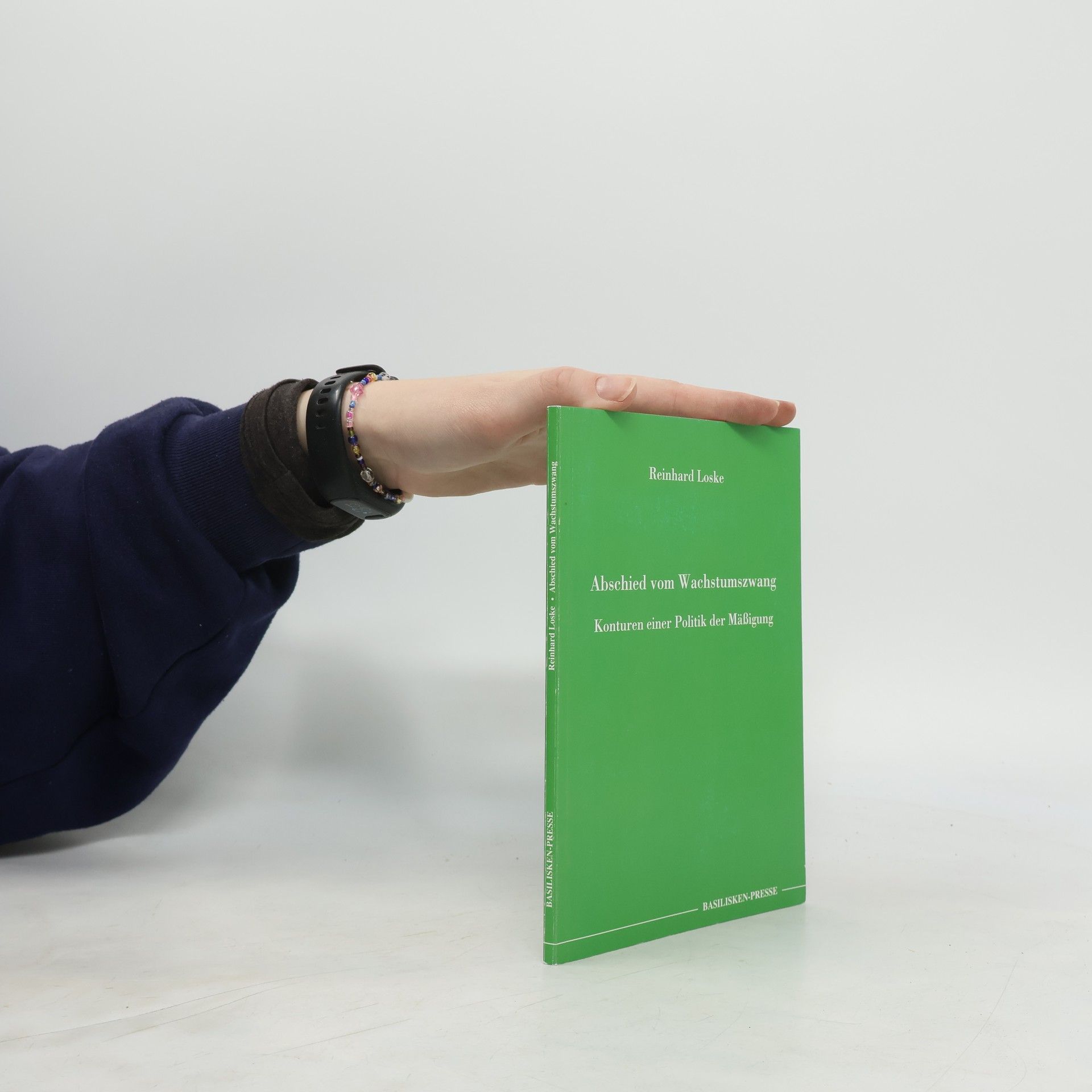

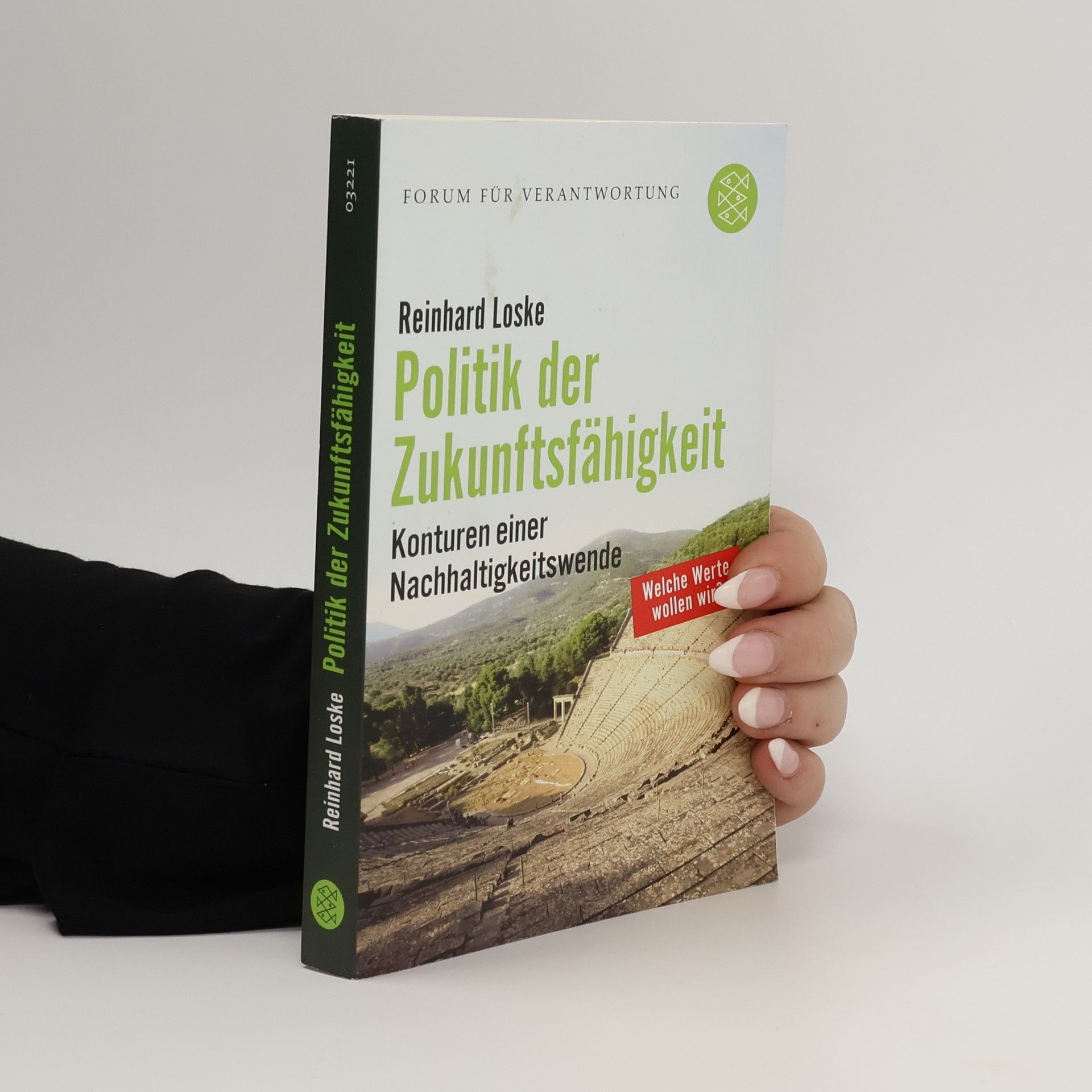
Mit „Abschied vom Wachstumszwang“ legte Reinhard Loske 2010 ein „fundamentales Pamphlet“ (Rupert Neudeck) vor, ein „kulturelles Projekt“ (Harald Welzer in der WELT), eine „Pionierarbeit“ (Christian Schwägerl). Die Frankfurter Allgemeine befand: „So radikal wie hier war der Ökologe Reinhard Loske noch nie.“ (Konrad Mrusek) Und Petra Pinzler konstatierte in der ZEIT: „Loske ist sicher: Nur durch bessere Technologie und zugleich kulturellen Wandel ist die Welt noch zu retten.“ In „Wie weiter mit der Wachstumsfrage?“ ging der Autor 2012 ausgiebig auf die durch seinen Wachstumsessay ausgelöste Debatte ein und setzte sich mit den Argumenten seiner Kritiker auseinander, und zwar „nicht mit Axt und Keule, sondern mit dem Florett“, so Fred Luks in der ZEIT. Seine Empfehlung: „Frau Merkel, lesen Sie!“ Ein gutes Jahrzehnt später, befasst sich Reinhard Loske noch einmal grundsätzlich und vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen mit der Wachstumsfrage. Die Kritik am Wachstumsfetischismus bildet aber nur den Ausgangspunkt seines Essays. Im Mittelpunkt stehen neue Formen des Wirtschaftens, die naturverträglich, gesellschaftsfördernd, global gerecht und enkeltauglich sind. Loske geht es um lebensdienliche „Ökonomien mit Zukunft“.
Abschied vom Wachstumszwang
Konturen einer Politik der Mäßigung
Die Vorstellung, dass die ökologische Krise der industrialisierten Welt allein durch technische Innovationen und grünes Wachstum gelöst werden kann, ist eine große Illusion. Obwohl erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz wichtig sind, bleibt ihre Umweltentlastung begrenzt in einer ständig wachsenden Wirtschaft. Der Wettlauf zwischen technischem Fortschritt und Wirtschaftswachstum erinnert an das Märchen von Hase und Igel: Der Hase kann sich anstrengen, doch der Igel bleibt unaufhaltsam und zeigt, dass ohne einen Kulturwandel hin zu Mäßigung keine nachhaltige Entwicklung möglich ist. Zudem wird das ständige Streben nach Wachstum nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus wohlfahrtsökonomischen Gründen kritisiert. Studien zeigen, dass mehr Wohlstand jenseits eines bestimmten Niveaus nicht zu mehr Glück führt, sondern den Blick auf die wesentlichen Dinge des Lebens verstellt. Die Idee, dass gerechte Verteilung nur in einer wachsenden Wirtschaft möglich sei, wird angesichts der gesellschaftlichen Spaltung immer fragwürdiger. Auch das Versprechen von Vollbeschäftigung durch Wirtschaftswachstum hat an Glaubwürdigkeit verloren. Der Autor plädiert für ein Ende der Wachstumsillusionen und beschreibt Wege, falsche Zwänge abzubauen und neue Bindungen zu schaffen, gestützt auf seine Erfahrung an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik.
Zukunftsfähiges Deutschland
- 453 páginas
- 16 horas de lectura
Die Umweltorganisationen Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und MISEREOR haben gemeinsam beim Wuppertal Institut eine Studie in Auftrag gegeben, die sich mit der Frage beschäftigt, wie ein „zukunftsfähiges Deutschland“ aussehen könnte. Ziel ist es, nachhaltige Entwicklung über bloße Rhetorik hinaus zu betrachten. Die Studie behandelt verschiedene Themenfelder, benennt die Grenzen der ökologischen Belastbarkeit, formuliert Umweltziele und berechnet Reduktionsziele. Besonders wichtig sind die Leitbilder, die Antworten auf grundlegende Fragen bieten, die in der aktuellen politischen Diskussion oft vernachlässigt werden. Wie kann ein demokratischer Industriestaat seine Strukturen so verändern, dass ökologische Grenzen eingehalten werden? Welche Rahmenbedingungen sind notwendig, um die Verhältnisse zwischen Nord und Süd gerechter zu gestalten? Die Studie verdeutlicht, dass ein „gutes Leben“ nicht von steigendem Bruttosozialprodukt oder wachsendem Energieverbrauch abhängt. Sie bietet Perspektiven und Alternativen zu den gängigen Narrativen und zeigt, dass es sich lohnt, technischen Erfindungsgeist und soziale Kreativität für eine lebenswerte Zukunft und globale Partnerschaften einzusetzen. Offen bleibt, dass einige Fragen umstritten sind und Widerspruch hervorrufen können.