Im Banater Grenzort Hatzfeld (rum. Jimbolia, serb. Zombolj, ung. Zsombolya) werden regionale und lokale Entwicklungstrends beleuchtet. Unter der Leitung von Professor Reinhard Johler untersucht ein multidisziplinäres Team des Tübinger Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde verschiedene Erzählungen des multikulturellen Marktfleckens. Die fünf Beiträge thematisieren den Wandel von der Ansiedlung des Ortes bis zur Gegenwart: die Gründung des Kolonistendorfs Hatzfeld im Jahr 1766, die lokale Bevölkerungsentwicklung, interethnische Beziehungen, staatliche und ökonomische Faktoren der ethnischen Diversität, den kulturellen Aufschwung der Kleinstadt und die Bildung von Deutungseliten sowie die Auswirkungen territorialer Veränderungen und Migration. Der Band bietet eine doppelte, text- und bildbasierte Narration des Ordnungswandels auf lokaler und regionaler Ebene. Das Autorenteam umfasst Experten mit Schwerpunkten in deutscher und südosteuropäischer Geschichte, Migration, Erinnerungskultur, historischer Demographie und Literaturwissenschaft. Sie bringen vielfältige Perspektiven ein, die die komplexe Geschichte und kulturelle Dynamik des Grenzortes Hatzfeld reflektieren.
Mathias Beer Libros
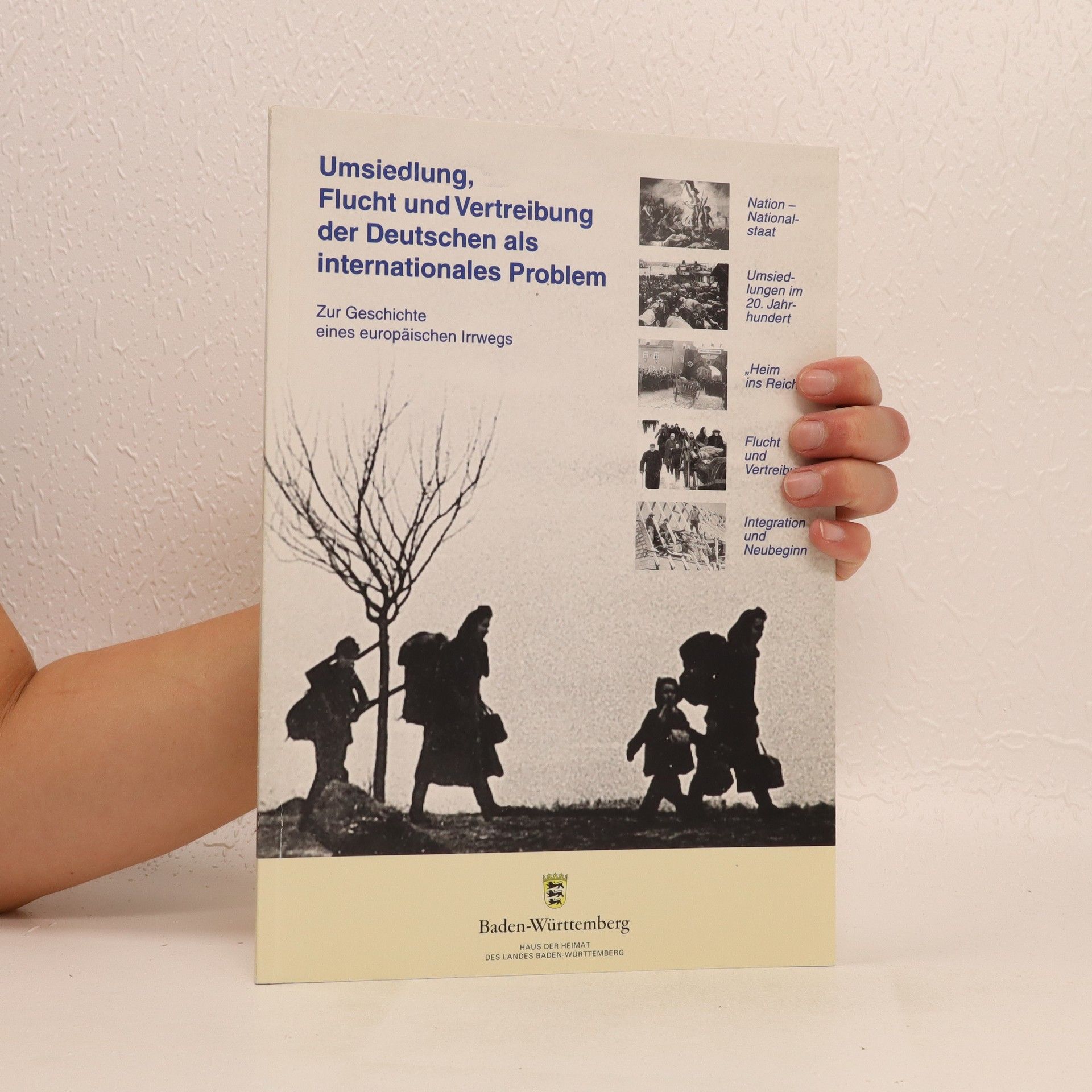
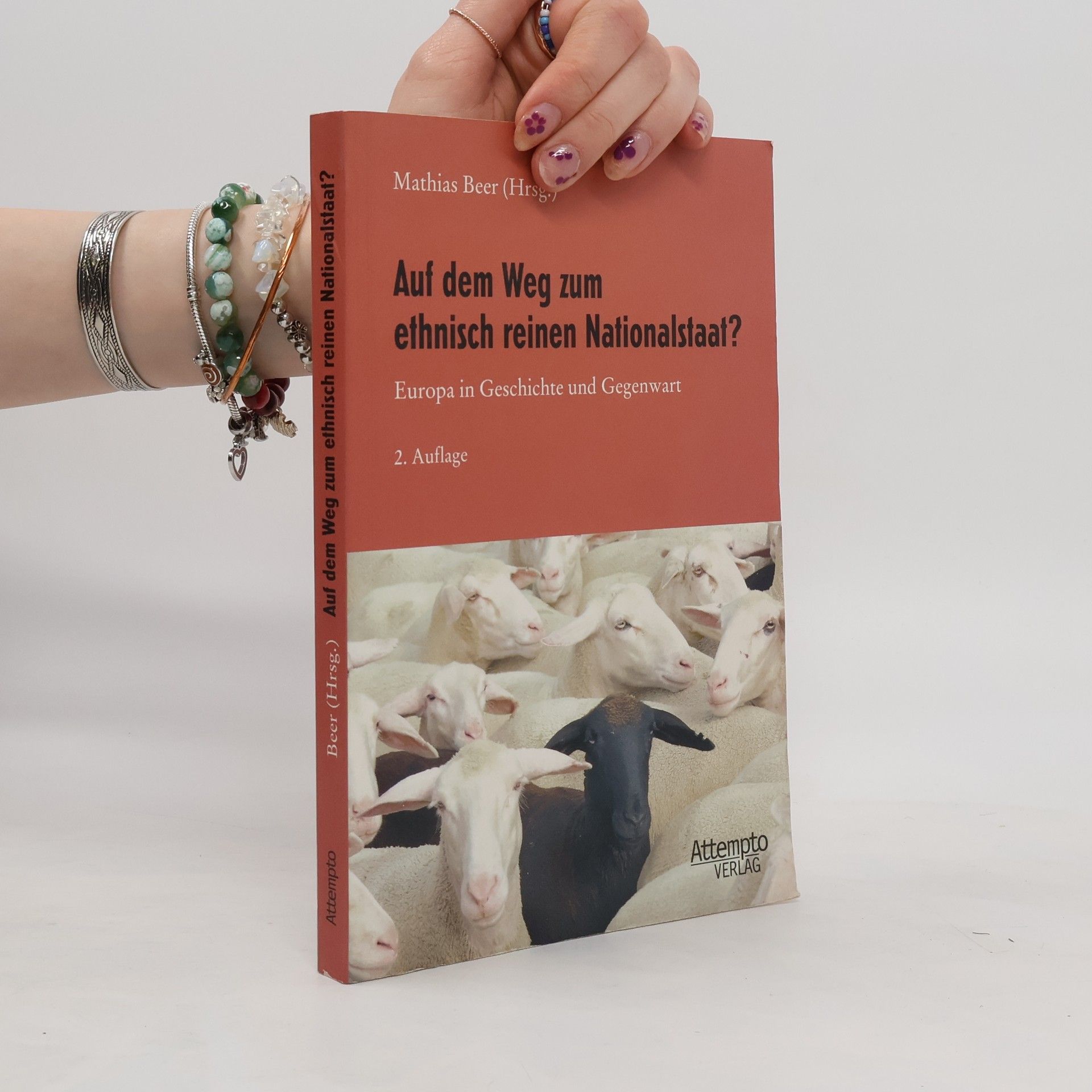




Der vom nationalsozialistischen Deutschland entfachte Zweite Weltkrieg setzte Europa in Bewegung: Soldaten und Kriegsgefangene, Emigranten und Flüchtlinge, Deportierte und Zwangsarbeiter wurden aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen. Seit der letzten Phase des Krieges traf das Inferno zunehmend auch die deutsche Bevölkerung. Millionen Deutsche verloren zwischen 1945 und 1950 ihre Heimat. Mathias Beer schildert den Verlauf der Vertreibung, macht deutlich, aufgrund welcher Voraussetzungen sie geschehen konnte und zeigt, welche Folgen die Bevölkerungsverschiebungen für die Nachfolgestaaten des Dritten Reiches hatten. Ein prägnanter und zuverlässiger Überblick für alle, die sich über die wichtigsten Fakten und Hintergründe dieser bis heute heftig umstrittenen Geschichte informieren wollen.
Migration und kulturelles Erbe
Das Beispiel der deutschen Minderheiten in und aus Rumänien
Kulturelles Erbe ist als soziokulturelle Praxis zu verstehen, die aufgrund vielfältiger Austauschprozesse im Laufe der Zeit einem Wandel unterworfen ist. Dementsprechend verändert sich das Kulturerbe stetig. Migrationen tragen in erheblichem Maß zu solchen Veränderungen bei, wie das Beispiel der deutschen Minderheiten in und aus Rumänien zeigt. Ihre fast vollständige Emigration nach 1945 vor allem in die Bundesrepublik wirft die Frage nach der Weiterentwicklung ihres materiellen und immateriellen Erbes im Herkunftsgebiet und Zielgebiet auf. Wer sind die Erben des kulturellen Erbes der deutschen Minderheiten nach ihrem fast vollständigen Verschwinden aus Rumänien und wie wird es tradiert, weiterentwickelt und verändert? Der Band setzt aus transnationaler Perspektive die Migrationsgeschichte der deutschen Minderheiten aus Rumänien nach 1945 und ihr kulturelles Erbe zueinander in Beziehung und greift damit ein Desiderat der Forschung auf.
Der politische Umbruch im Donau-Karpatenraum am Ende des 17. Jahrhunderts erweist sich als tiefe Zäsur. Schrittweise verändern sich die Rahmenbedingungen, die im Laufe des 18. Jahrhunderts in der Stadt mehr als auf dem Land zu grundlegenden Veränderungen führen. Alte Diversitäten werden von neuen abgelöst oder konkurriert, was sich bei der Privatsphäre ebenso erkennen lässt wie im öffentlichen Raum. Obwohl in jener Periode die „Europäisierung" voranschreitet, kommt der besagte Schauplatz dennoch nicht aus der Peripherie des allgemeinen Wandels heraus.
Auf dem Weg zum ethnisch reinen Nationalstaat?
Europa in Geschichte und Gegenwart
Der Prozess der modernen Nationalstaatsbildung war von Anfang an gewaltdurchtränkt - nach außen und nach innen. Wie man sich feindselig vom Nachbarstaat abgrenzte, so grenzte man im Landesinnern all jene aus, die aus der Sicht des Staatsvolkes als nicht dazu gehörig, als fremd galten. Um die ethnische Homogenität Einheit und Reinheitder Nation zu erreichen, warmanchen jedes Mittel Recht.: Assimilierung, Umsiedlung, Vertreibung und Vernichtung der einmal hinausdefinierten religiösen, sprachlichen oder ethnischen Minderheiten prägten die neuere europäische Geschichte. Und heute? Wie vertragen sich Nationalstaat undverträgt sich das Streben nach nationaler Homogenität mit den Herausforderungen der Moderne, mit Globalisierung, Migration, demographischem Wandel, und europäischem Einigungsprozess und Neuordnung in Osteuropa? In diesem Buch antworten Experten - mit Blick in die Vergangenheit und die Gegenwart.
Flüchtlinge und Vertriebene im deutschen Südwesten nach 1945
Eine Übersicht der Archivalien in den staatlichen und kommunalen Archiven des Landes Baden-Württemberg
- 414 páginas
- 15 horas de lectura
