Kaum einen Jäger in Österreich gibt es, der nicht von Hermann Prossinagg etwas über die Geschichte der Jagd gelernt hat. Sein Buch „Österreichs Jagd im 20. Jahrhundert“ ist längst Legende und ein Muss in jedem gepflegten Jägerhaushalt. Was aber immer noch einer gründlichen jagdgeschichtlichen Darstellung harrte, das waren die Kaiserlichen Jagdgebiete in den Donau-Auen, wie etwa der Prater. Wer weiß zum Beispiel heute noch, wer die „Praterhanseln“ waren: die kaiserlichen Hirsche. Oder dass es einen Mann namens „Bengel“ wirklich gegeben hat: ein kaiserlicher Jäger und Grobian, der die Wiener Bevölkerung verklopfte, wenn sie die Jagdgründe betraten; heute ist der „Bengel“ Bestandteil unserer Alltagssprache. Wer weiß, dass es einst einen derart erbitterten Kampf um eine Au gegeben hat, dass man diese letztlich die „Kriegs-Au“ nannte: die heutige Krieau. Soweit nur einige wenige Beispiele dafür, was Hermann Prossinagg zur Geschichte der Kaiserlichen Jagdreviere in den Donau-Auen zutage gefördert hat. Er greift in seiner Darstellung der Gebiete in den Donau-Auen aber viel weiter zurück als nur auf Habsburg-Zeiten, etwa auf Wien zur Zeit der Römer, und wie die Donau damals ausgesehen haben mag. Die Donau-Auen wurden damals noch kaum betreten, sie waren feindlich, doch boten sie auch guten Schutz vor Feinden, vor allem zum Nordosten hin.
Hermann Prossinagg Libros

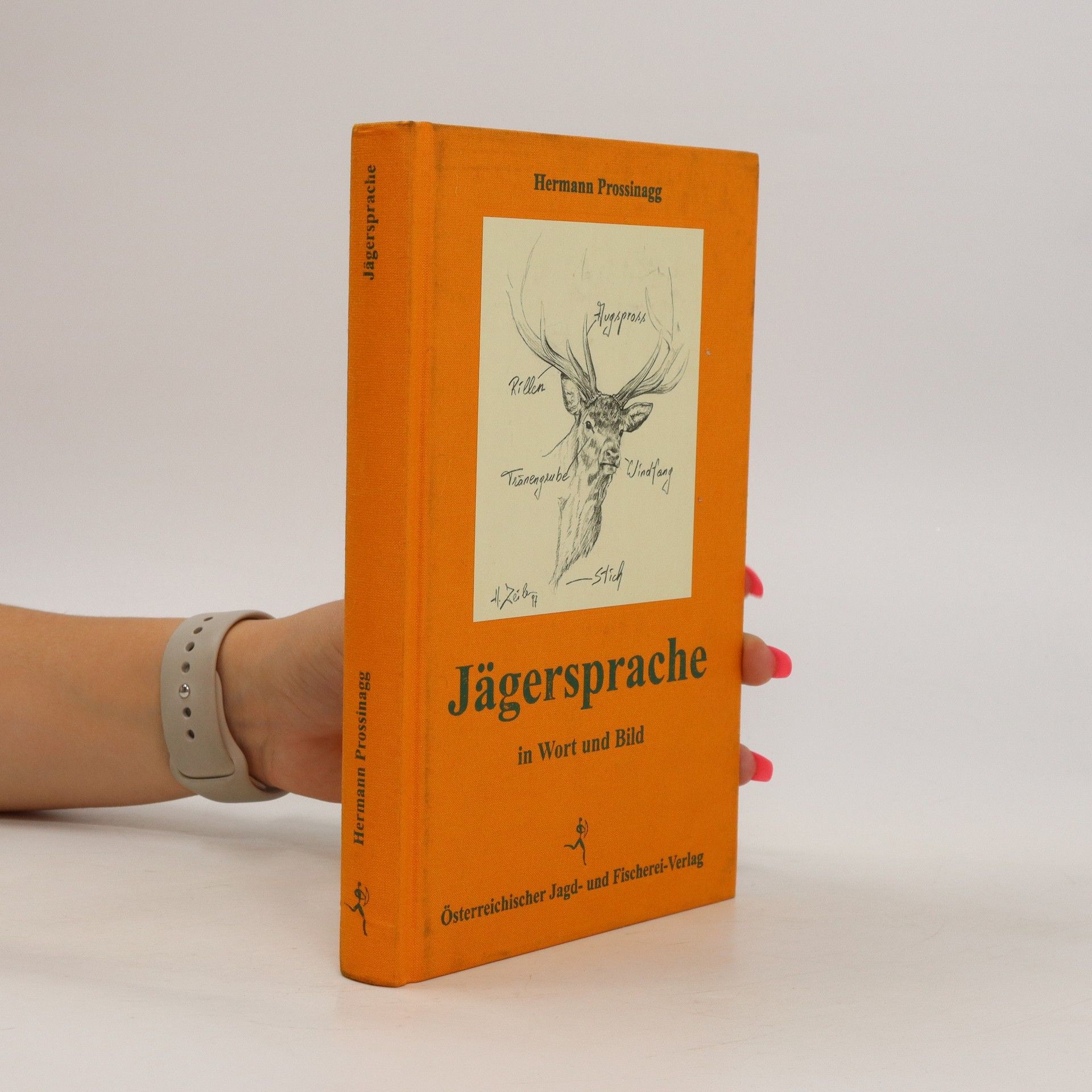
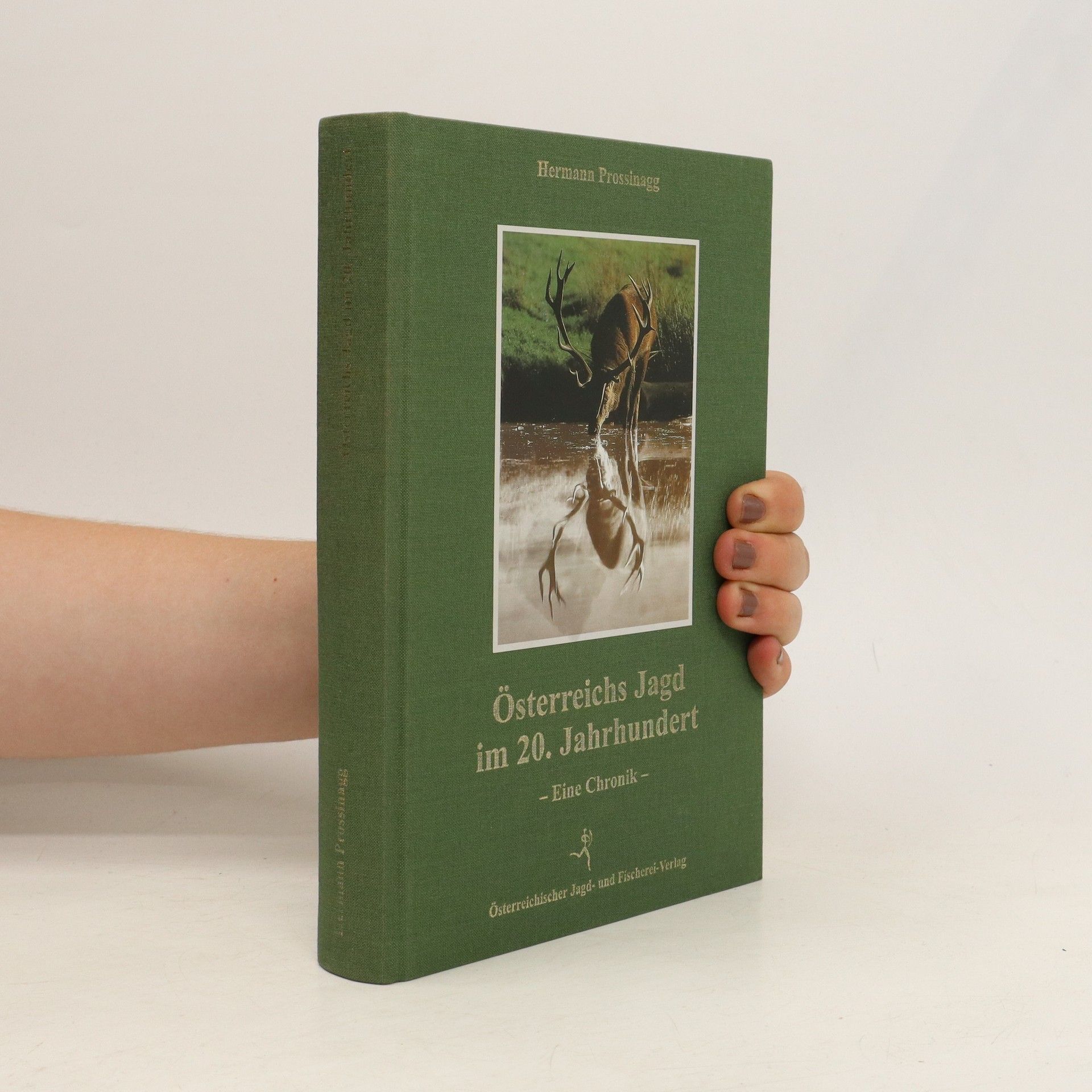

Österreichs Jagd im 20. Jahrhundert
Eine Chronik
Jeder Schritt in der wechselvollen Geschichte Österreichs im 20. Jahrhundert hat seine Spuren in der Jagd hinterlassen. Der Autor, Senatsrat Dipl.-Ing. Hermann Prossinagg, erlebte viele dieser Ereignisse als Augenzeuge. Er schildert die Euphorie, als das Reichsjagdgesetz auch die österreichischen Jäger in Uniformen kleidete und die chaotischen Zustände der Zwischenkriegszeit mit einer straffen Organisation beseitigt wurden. Das bitterste Ende kam mit dem großdeutschen Reich, als Österreich und seine traditionsreiche Jagd untergingen und Maschinengewehrsalven auf das Wild niedergingen. Der Wiederaufbau der Wildstände wurde von beherzten Männern vorangetrieben, gefolgt von Zeiten des Wohlstands, in denen die Fütterungsfrage zur Kardinalfrage der Hege erhoben wurde. Technische Innovationen fanden zunehmend Einzug in die Jagd, und die Reviere wurden komfortabler ausgestattet. Die Jahrzehnte, die Prossinagg nicht selbst miterlebte, erarbeitete er sich durch unermüdliches Studium. Sein persönliches Interesse an der Jagd in der Monarchie und seine Tätigkeit als Jagdreferent der Stadt Wien ermöglichten ihm, die Aufzeichnungen des k. u. k. Oberstjägermeisteramtes genau zu studieren. Die Fülle an geschichtlichem Material, die er dabei entdeckte, ist bemerkenswert. Ein Jahrhundertwerk und ein Vermächtnis des großen Jagdhistorikers Hermann Prossinagg.
Die Sprache der Jäger lebt. Sie steht tagtäglich in den Revieren auf dem Prüfstand. Sie bleibt dabei offen für Veränderung, ohne aber ihren Kern preiszugeben. In Stein gemeißelte Gesetze kennt sie nicht. Im Kern der Jägersprache haben sich die Erfahrungen von Generationen zu einem ungemein treffsicheren, lautmalerischen und lebendigen Ausdrucksmittel verdichtet. Auf diesen lebendigen Kern zielt das Buch „Jägersprache in Wort und Bild“ ab. Diesen Kern klar gegliedert, anschaulich und einfach handhabbar zu bewahren, stand bei dem längst zum Standardwerk gereiften Buch im Vordergrund. Darüber hinaus verdichten in diesem Buch über 30 eindrucksvolle naturnahe Zeichnungen von Hubert Zeiler Sprache und Bild – wie in der Jagd selbst – zu einer lebendigen Einheit. Kaum von Bedeutung war hingegen die lückenlose Vollständigkeit oder die Beantwortung akademischer Fragen wie etwa jener, ob sich die „Geiß“ korrekterweise mit „ei“ oder „ai“ schreibe. Der Blick galt ausschließlich dem Wesentlichen. Nicht nur die Jägersprache lebt mit diesem Buch weiter, sondern auch noch etwas Anderes: Das große Werk von Hermann Prossinagg, dem Grandseigneur der österreichischen Jagdgeschichte. Mit Begeisterung und Freude hat er die umfassende Arbeit zu diesem Buch geleistet und damit den fruchtbaren Boden dafür bereitet, auf dass es auch künftigen Jägergenerationen nicht die Sprache verschlage.