Im September 1808 begegnen sich in Erfurt zwei Männer, die Weltgeschichte geschrieben haben – der eine ist der größte Dichter seiner Zeit, der andere der mächtigste Mann Europas. Goethe trifft auf Napoleon. Es entspinnt sich ein Dialog unter Genies, der durch ein Wort Napoleons – „Vous êtes un homme“ – unsterblich geworden ist. Gustav Seibt schildert in seinem historischen Essay die Geschichte dieser Begegnung zweier Jahrhundertmenschen und entfaltet zugleich ein Panorama der napoleonischen Epoche.
Gustav Seibt Libros
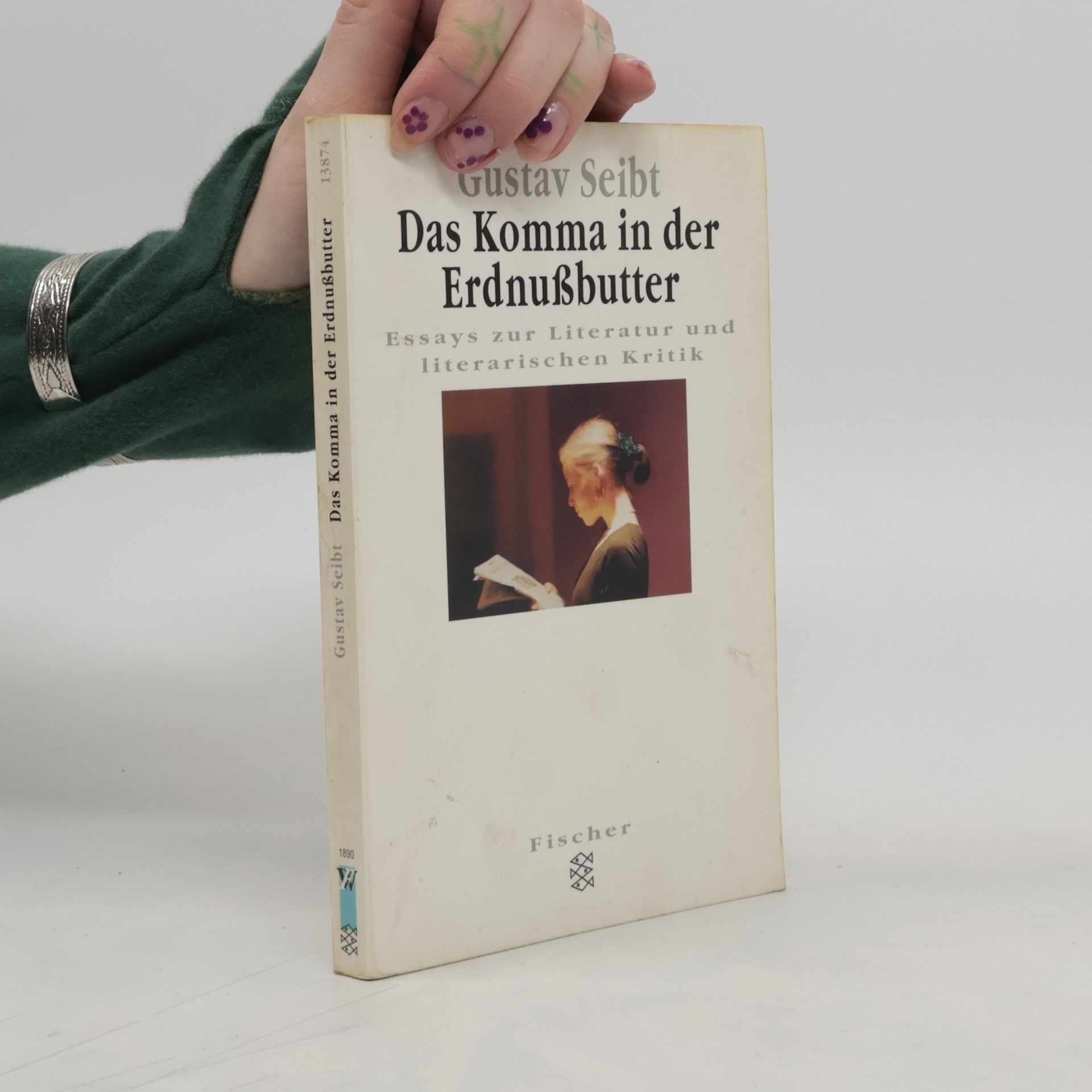
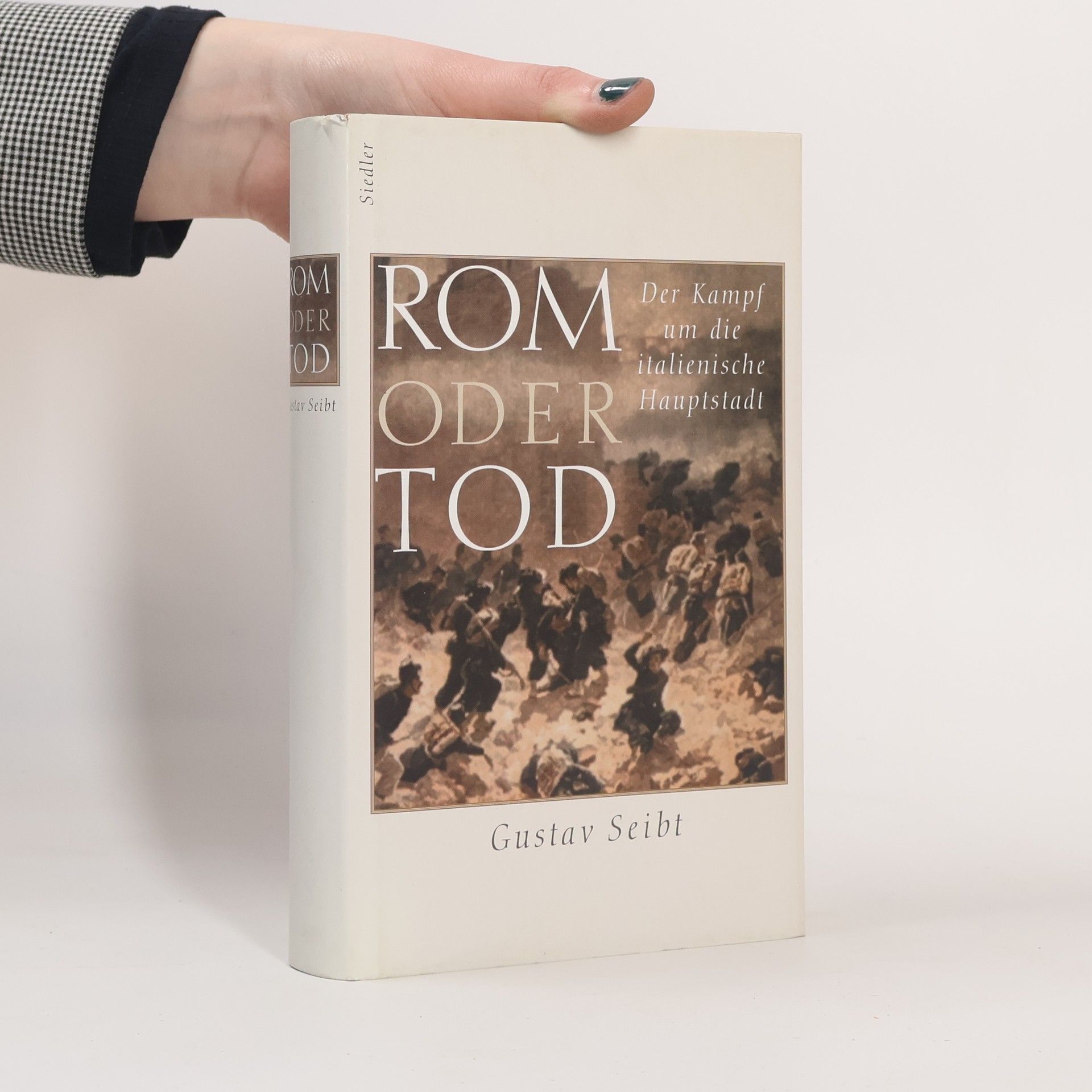

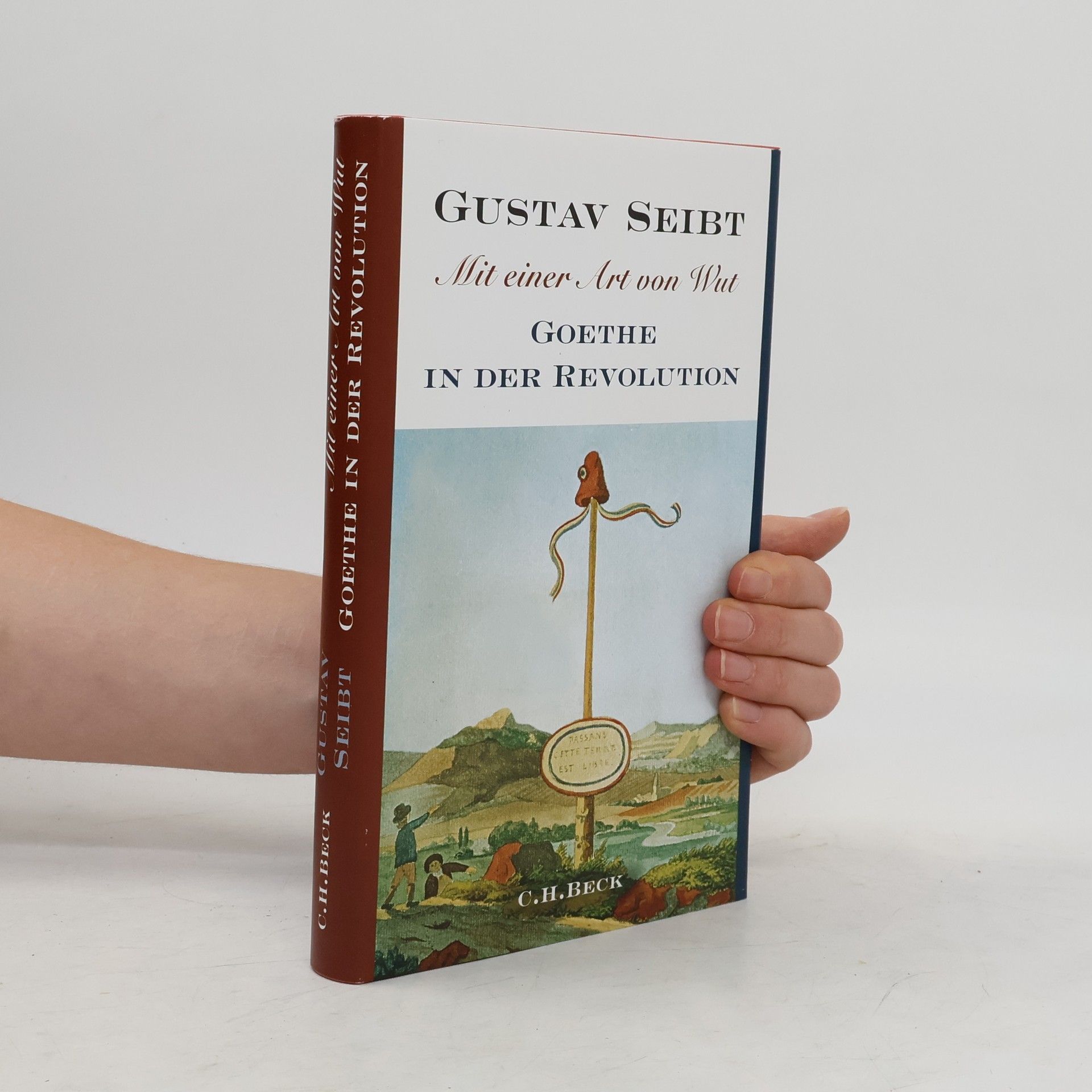


In außerordentlichen Zeiten
Politische Essays
Gustav Seibt erweitert in brillant formulierten Essays für die «Süddeutsche Zeitung» den Horizont seiner Leser, indem er das Besondere des Augenblicks in größere Zusammenhänge einordnet und historische Tiefendimensionen hinzufügt. Seine luziden Texte bieten ein befreiendes Gefühl, die „Lage“ besser zu verstehen und entkommen so der temporalen Platzangst der Zeitgenossenschaft. In „In außerordentlichen Zeiten“ vereint Seibt seine besten Texte zu einer Vermessung der Gegenwart, die Themen wie den Umgang mit Flüchtlingen und das schwierige Verhältnis zu Russland behandelt. Als einer der angesehensten deutschen Publizisten ist Seibt für seine humanistisch-liberale Grundhaltung und weitgespannten historischen Kenntnisse bekannt. Er gelingt es, über tagespolitische Stellungnahmen hinaus das Grundsätzliche einer Situation aufzuzeigen und durch historische Betrachtungen ein besseres Verständnis für aktuelle Geschehnisse zu ermöglichen. Dieser Band bietet die Gelegenheit, sich in makelloser Prosa über die Grundfragen unseres Zeitalters – wie Flüchtlinge, Islam und Islamismus, die Fliehkräfte der EU und das Verhältnis zu Russland – zu informieren. Seibt liefert eine brillante Tour d’Horizon durch unser politisches Zeitalter.
Goethe war kein Freund der Französischen Revolution. Er nannte sie „das schrecklichste aller Ereignisse“ und erklärte: „Ihre Greuel standen mir zu nahe.“ Gustav Seibts fulminante Untersuchung zeigt, wie wörtlich das zu verstehen ist, und führt uns mitten hinein in die Belagerung von Mainz 1793, die Goethe als Augenzeuge und als Handelnder miterlebte. Nach „Goethe und Napoleon“ widmet sich Gustav Seibt nun in einem weiteren ebenso eleganten wie klugen Buch der Revolutionserfahrung Goethes. Was hat sich im Juli 1793 wirklich abgespielt? Warum mündete die Mainzer Republik in Wochen des Bürgerkriegs und reaktionären Terror? Welche Rolle hat Goethe in diesen verstörenden Ereignissen gespielt und wie hat er sie gedeutet? All diesen Fragen geht Seibt immer nah an den Quellen nach und beleuchtet dabei nicht nur Goethes Haltung zum wichtigsten Umbruch seiner Epoche neu, sondern wirft auch ein ungewohntes Licht auf eine fatale Weichenstellung in der deutschen Geschichte - Deutschlands Abwendung von den Idealen der Französischen Revolution. Seibts Buch ist eine grandiose Erzählung von Terror und Wut und dem Versuch, den Kreislauf der Gewalt zu unterbrechen.
Canaletto im Bahnhofsviertel
- 206 páginas
- 8 horas de lectura
Kulturkritik als weltzugewandte, durchaus heitere Geschichtsskepsis: Warum sie zum guten Leben in einer Zivilisation gehört, zeigen diese elegant formulierten Auseinandersetzungen mit der Zukunft und Vergangenheit Europas sowie mit den Ausdrucksmöglichkeiten von bildender Kunst und Literatur. Gustav Seibt ist der Gestus des schlecht gelaunt raunzenden, habituell Neues abwehrenden Kulturkritikers fern. Ganz gleich, ob er sich Petrarca oder dem Berliner Tag- und Nachtleben zuwendet, stets sind seine Einlassungen Ausdruck eines fröhlichen Gegenwartsbewußtseins. Sämtliche hier versammelten Essays – ob zu Borchardt, Nietzsche, Weber, Thomas Mann oder zum deutschen Bildungsbürger – stellen sich der Frage nach Abhängigkeit und Autonomie geistiger Leistung und nach dem Zusammenhang von Freiheit und Geschichtsbewußtsein. Ergänzt werden sie durch autobiographisch geprägte Miniaturen und amüsantabgründige Einblicke in das Leben einer nicht nur architektonisch zerrissenen Hauptstadt.
Zehn Jahre sind zwischen dem Hauptstadtbeschluss des Parlaments und dem Umzug der Regierung verstrichen: Nicht von Berlin ist die Rede, nicht vom heutigen Deutschland, sondern von Rom und Italien im neunzehnten Jahrhundert. Italien wurde 1861 geeinigt, 1871 bezog es seine Hauptstadt Rom. Es gab lange Hauptstadtdebatten davor und einen ebenso langwierigen Umbau der Stadt danach. Darum hatte es einen Krieg gegeben: Italien hatte die Stadt Rom dem Papst mit militärischen Mitteln entreißen müssen. Und neben dem Krieg der Waffen fanden andere Kämpfe auf den Schlachtfeldern der Presse, der Diplomatie, der Geschichtswissenschaft und der Theologie statt: Gestritten wurde um Fortschritt und Legitimität, Religion und Revolution, Kirche und Nation. Schriftsteller und Gelehrte aus ganz Europa beteiligten sich daran und erörterten dabei Grundsatzfragen der Moderne: nationale Identität, Gewissensfreiheit, Selbstbestimmungsrecht der Völker. Gustav Seibt erzählt die Geschichte dieses vergessenen Kampfes, der damals Millionen Menschen bewegt hat, mit ihren vielfältigen Bezügen und Ebenen: der militärischen, der diplomatischen, der weltanschaulichen und der stadthistorischen. Dabei entsteht ein farbiges Bild vom Übergang Alteuropas zum Europa der Nationen zwischen der Revolution 1848 und den Lateranverträgen 1929. Seibts Buch ist ein Abgesang auf das alte Rom der Päpste und eine Liebeserklärung an das freiheitliche Italien des Risorgimento.
Literaturkritik ist eine Kunst, die beherrscht sein will. Mit der selbstgefällig sich in Szene setzenden Subjektivität des dekretierenden Geschmacksrichters hat sie wenig zu tun. Mit einer vermeintlichen Objektivität der Urteile allerdings ebensowenig. Die Stimme des Kritikers muß deutlich und erkennbar sein, doch nicht in eigener Sache, sondern um die Kriterien einsichtig zu machen, an denen das kritische Urteil nicht nur die Texte, sondern auch sich selbst erprobt. Gustav Seibts Essays führen vor, wie ein solcher Umgang mit Literatur aussehen kann: Sie widmen sich einzelnen Büchern und Porträts von Autoren, literarischen Debatten und der Rolle der Kritik.
Bibliothek Suhrkamp: Rudolf Borchardts Leben von ihm selbst erzählt
Nachw. v. Gustav Seibt
- 168 páginas
- 6 horas de lectura
Der 125. Geburtstag von Rudolf Borchardt am 9. Juni 2002 bietet die Möglichkeit, das Werk dieses bedeutenden Dichters und Übersetzers neu zu entdecken. Borchardt, geboren 1877 in Königsberg, thematisierte in seinen Kindheitserinnerungen und Schriften das Ringen um das Vergangene und die Bildung des eigenen Geistes.
