Karl der Grosse, das Papsttum und Byzanz
- 107 páginas
- 4 horas de lectura
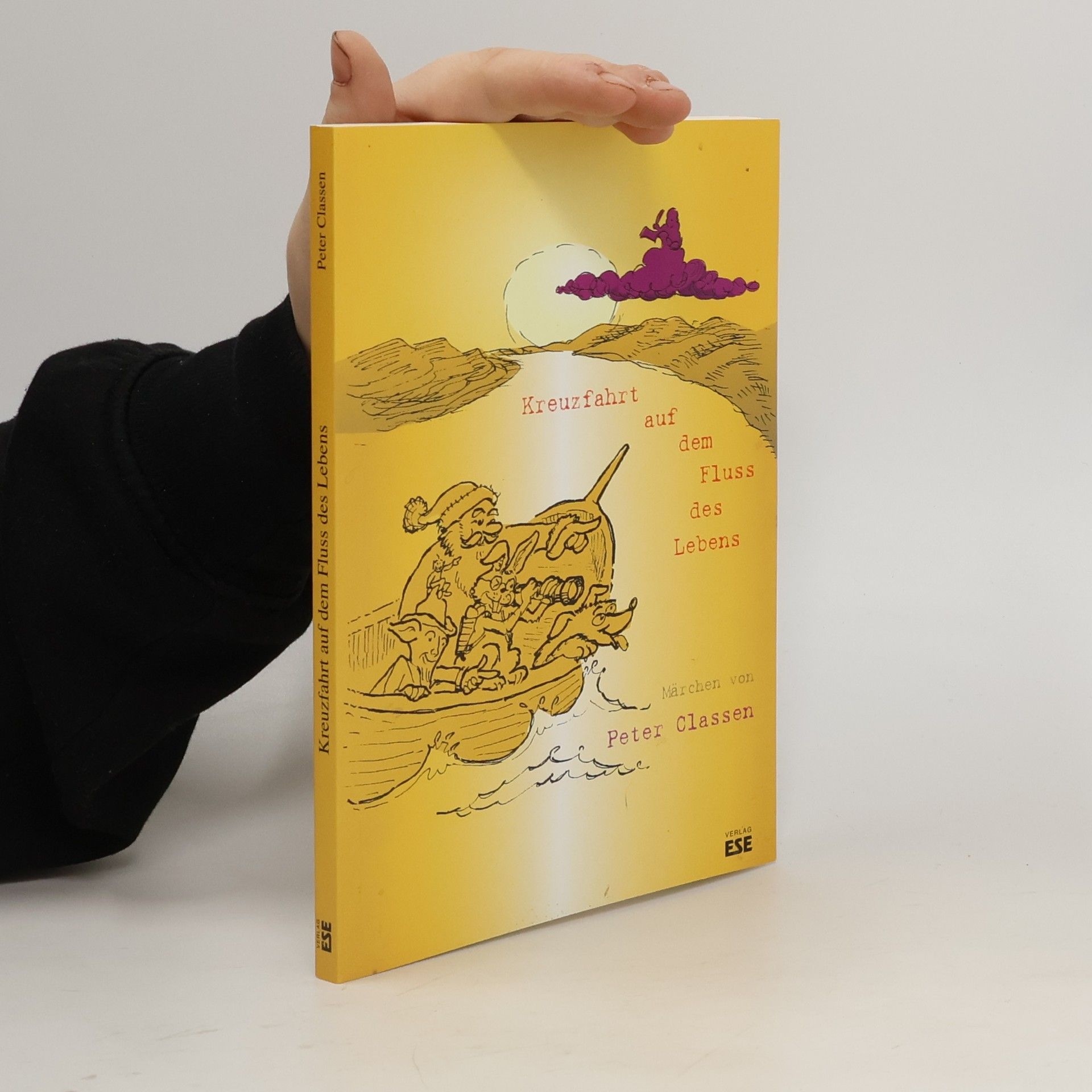

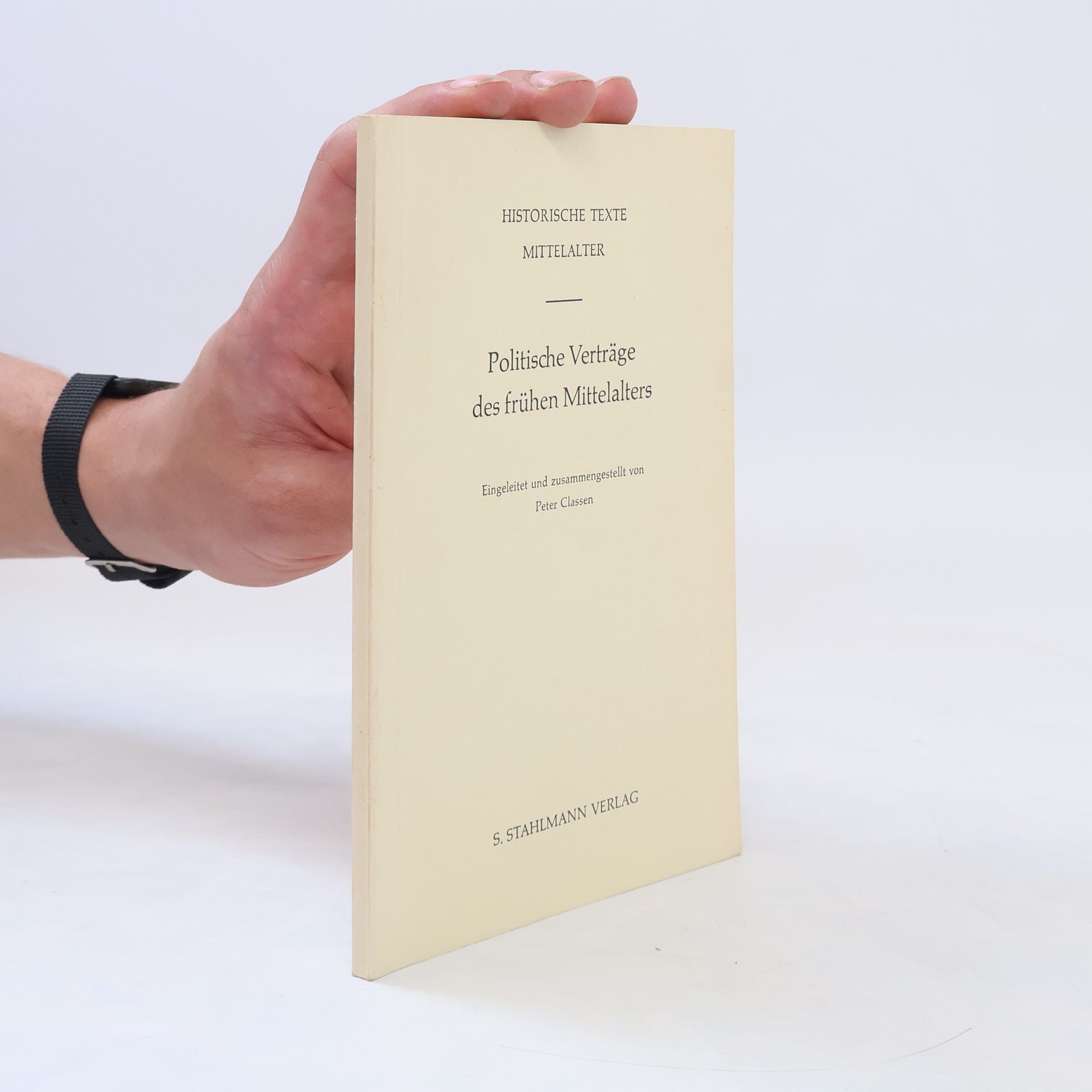

Der Inhalt umfasst mehrere zentrale Themen der Übergangszeit von der Spätantike zum Mittelalter. Zunächst wird der erste Römerzug in der Weltgeschichte und die Entwicklung des Kaisertums im Westen behandelt, einschließlich der Kaiserkrönung in Rom zwischen Theodosius und Karl dem Großen. Es werden die Probleme Roms in dieser Zeit sowie die spät-römischen Grundlagen der mittelalterlichen Kanzleien thematisiert. Ein weiterer Abschnitt beleuchtet die Beziehung zwischen Byzanz und dem Westen, insbesondere Italien zwischen Byzanz und dem Frankenreich, das Konzil von Konstantinopel 1166 und die Loyalität Mailands gegenüber Manuel Komnenos. Die Rolle Karls des Großen und der Karolinger wird in Bezug auf die Kaisertitulatur und die Thronfolge im Frankenreich untersucht, ebenso wie die politischen Grundlagen des westfränkischen Reiches durch die Verträge von Verdun und Coulaines 843. Im hohen Mittelalter wird die Frühscholastik in Österreich und Bayern sowie eschatologische Ideen und Armutsbewegungen des 11. und 12. Jahrhunderts behandelt. Ein weiterer Abschnitt widmet sich Gerhoch von Reichersberg, seinen Werken und dem Häresiebegriff in seinem Umfeld. Abschließend werden Königspfalzen und Herrschaftszeichen, insbesondere die Bedeutung der Krone im 12. Jahrhundert, thematisiert. Eine Bibliographie und Register runden den Inhalt ab.