Das Transsubjektivitätsprojekt
Ein Zugang zur methodisch-konstruktiven Ethik
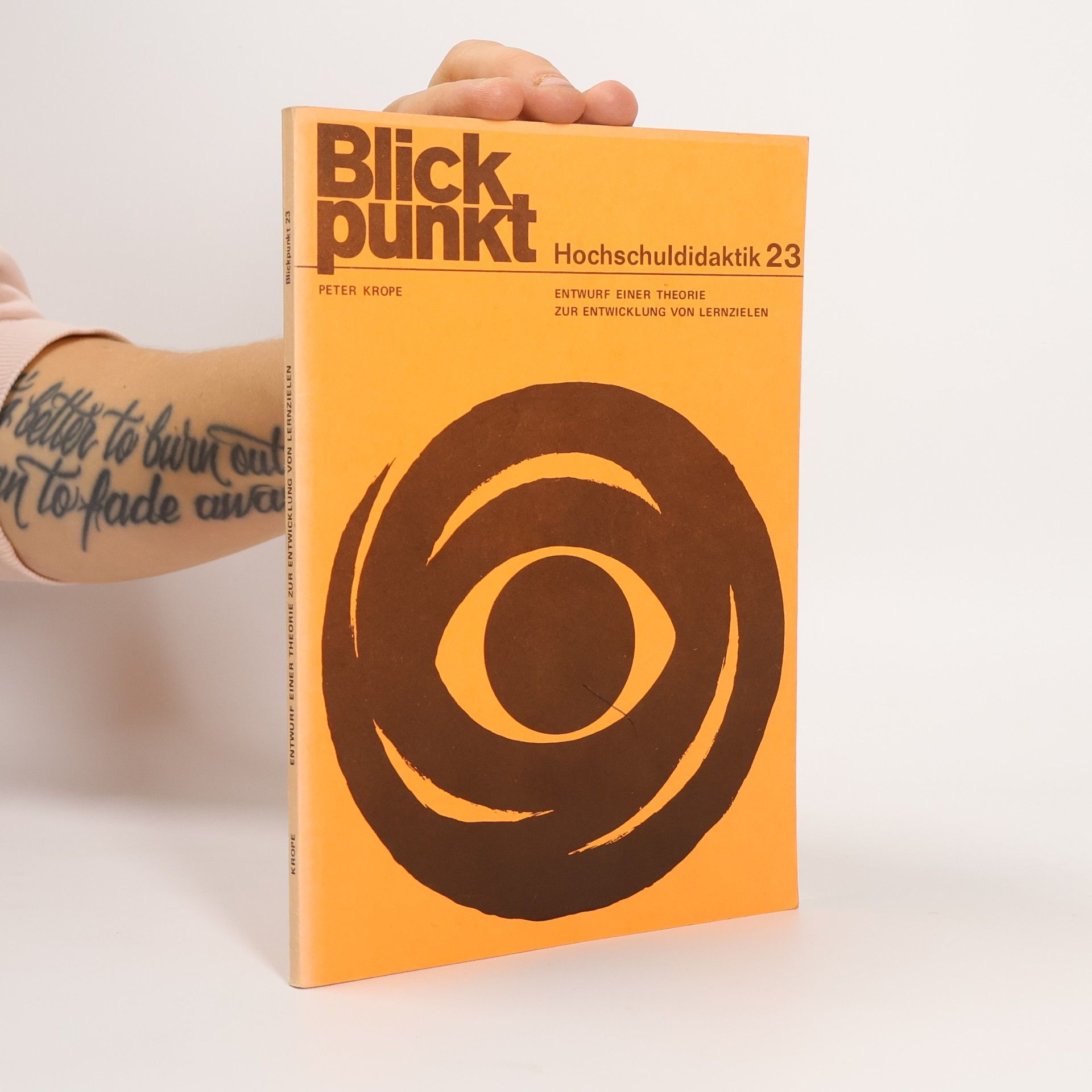


Ein Zugang zur methodisch-konstruktiven Ethik
In diesem Büchlein wird die Frage abgehandelt, wie eine empirische Sozialwissenschaft Er-kenntnisse über ihre Gegenstände gewinnen kann. Zur Beantwortung wird ein methodisch-konstruktives Moment der Gegenstandskonstitution in fünf Aufsätzen aus unterschiedlichen Blickrichtungen dargestellt. Die Titel sind erstens „Von der Gewalterzählung zur Gewaltdefi-nition. Methodisch-konstruktive Sprachbildung und Gewaltprävention“. Zweitens „Fremdes als Gegenstand einer Erfahrungswissenschaft“. Drittens „Statistische Wahrscheinlichkeit in den Sozialwissenschaften. Eine Analyse auf methodisch-konstruktiver Grundlage“. Viertens „Empirische Sozialwissenschaft zwischen Gegenstandsebene und Darstellungsebene“ und fünftens „Synthetische Aussagen in der empirischen Sozialwissenschaft“.
Hochschuldidaktik. Heft 23