Helmut Engelbrecht Libros

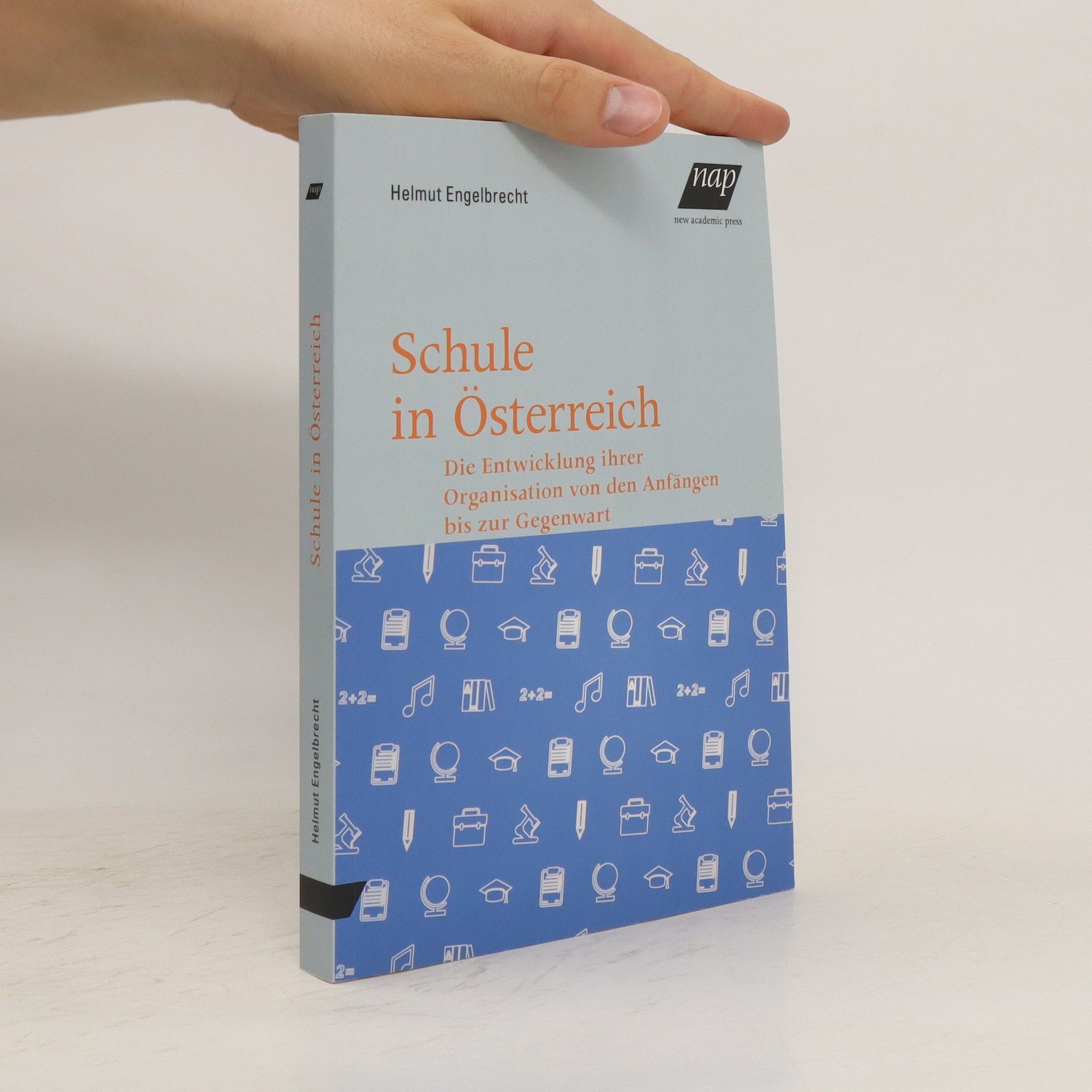
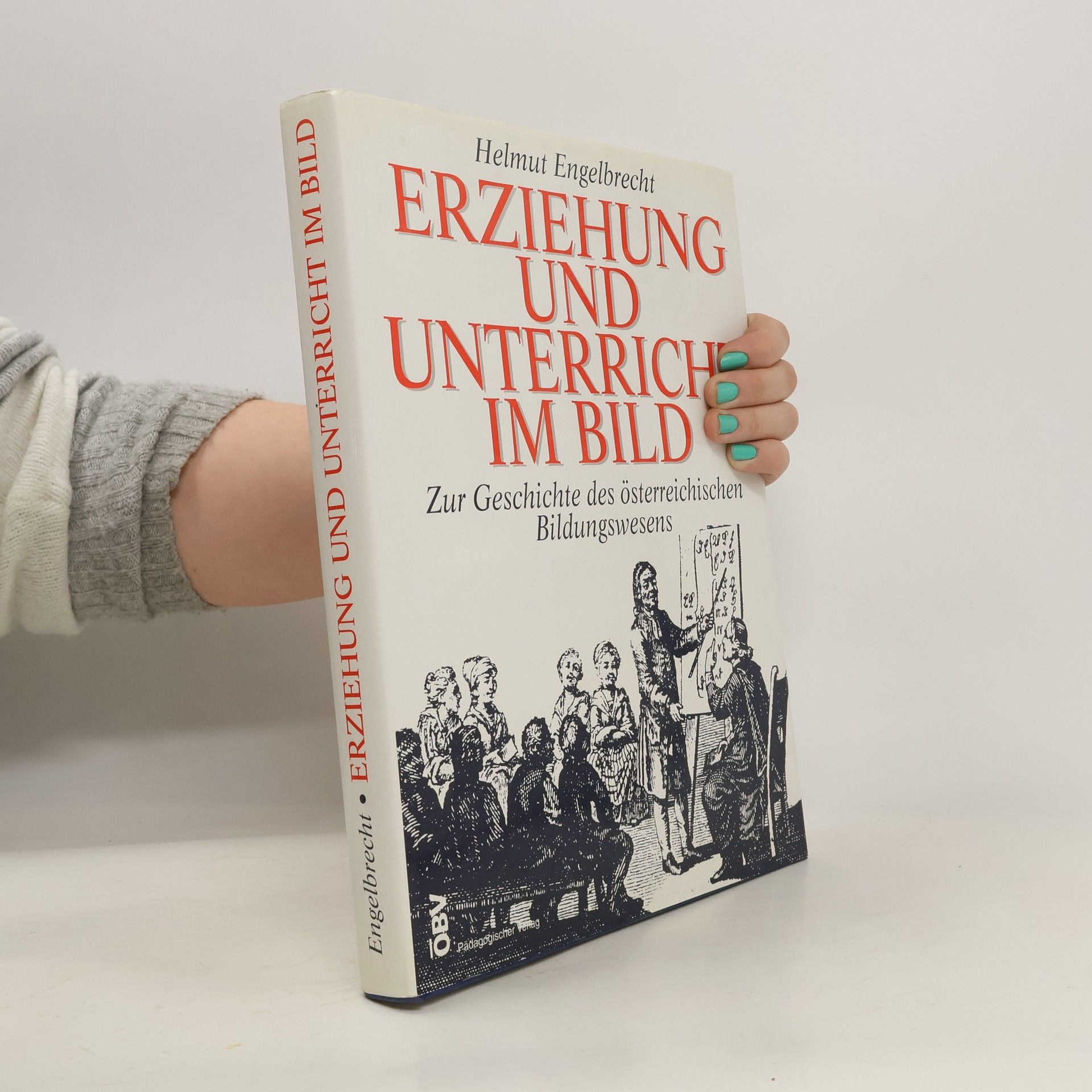
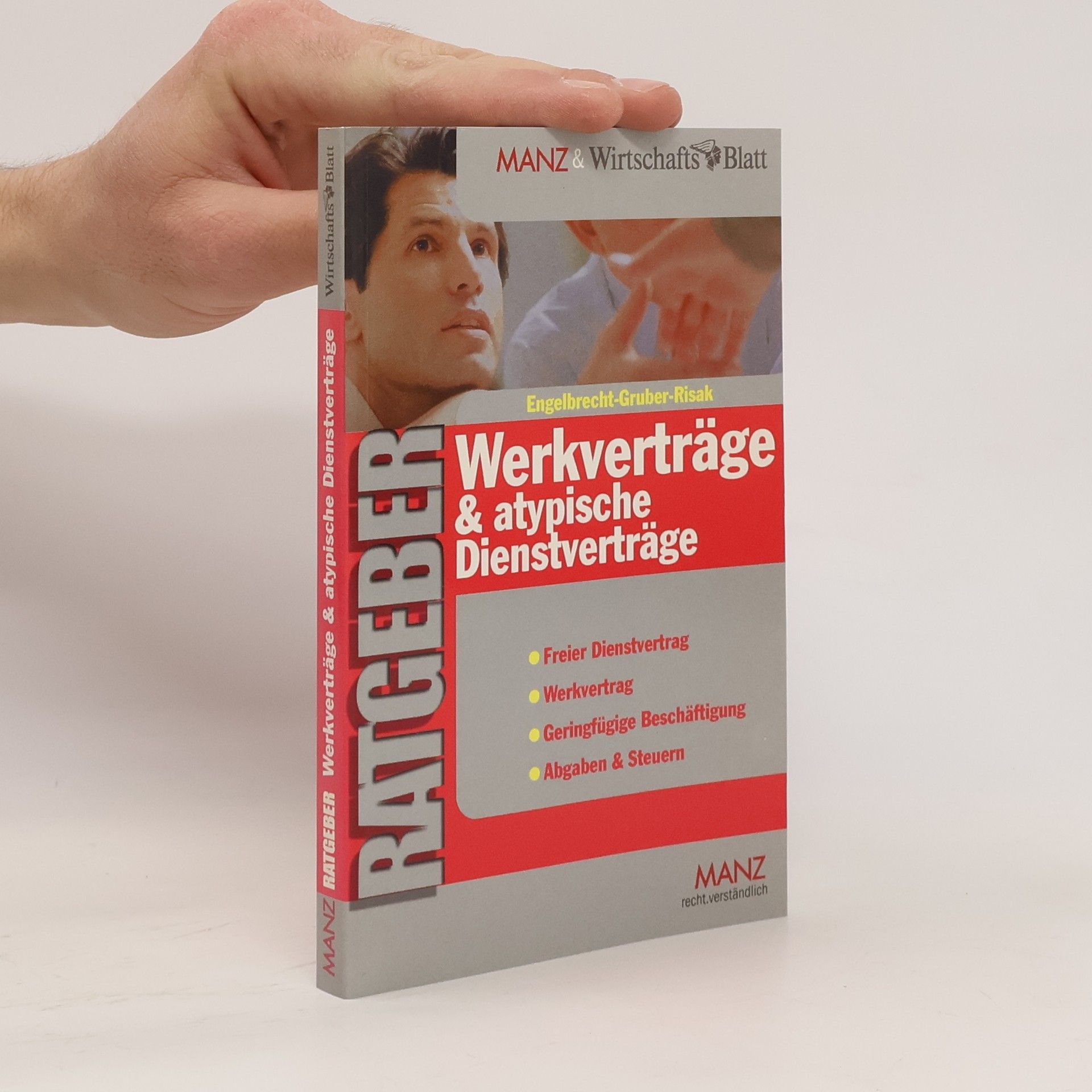
Dieser Bildband ergänzt einerseits das fünfbändige Standardwerk „Geschichte des österreichischen Bildungswesens“ vom selben Autor, andererseits bietet es allen, die sich für diesen wichtigen Bereich der Kulturgeschichte interessieren, einen raschen Überblick über die Entwicklung des Lehrens und Lernens in Österreich.
Mit dem Wort „Schule“ verbindet jeder etwas, und das Thema berührt viele Menschen – positiv wie negativ. Erinnerungen an die ersten Schultage oder bestimmte Personen sind tief verankert. Neben der Familie ist die Schule eine der wichtigsten Institutionen der Sozialisation. Doch wie entwickelte sich die Schule zu dem, was sie heute ist? Diese Darstellung beleuchtet die Organisation der Schule von den Anfängen im Mittelalter bis zur Gegenwart und zeigt, wie sie auf die Herausforderungen einer sich wandelnden Gesellschaft reagierte. Zentrale Streitfragen wie Zentralismus versus Autonomie, Vereinheitlichung versus Differenzierung, sowie Themen wie Unterrichtszeit, Zugangsberechtigungen und die Ausbildung der Lehrkräfte werden in den verschiedenen historischen Phasen behandelt. Das Schulwesen nimmt heute eine Schlüsselposition in Staat und Gesellschaft ein, und gesellschaftliche Veränderungen führen oft zu neuen Anforderungen an das Schulsystem. Der Staat hat von Anfang an versucht, durch organisatorische Maßnahmen und Einflussnahme auf Lehrinhalte seine Ziele zu verwirklichen. Ein Rückblick hilft zu verstehen, warum in Österreich seit Jahren Stillstand herrscht und warum das Bildungssystem von Eltern, Lehrkräften und Experten kritisch betrachtet wird.