Reinhard Weber Libros


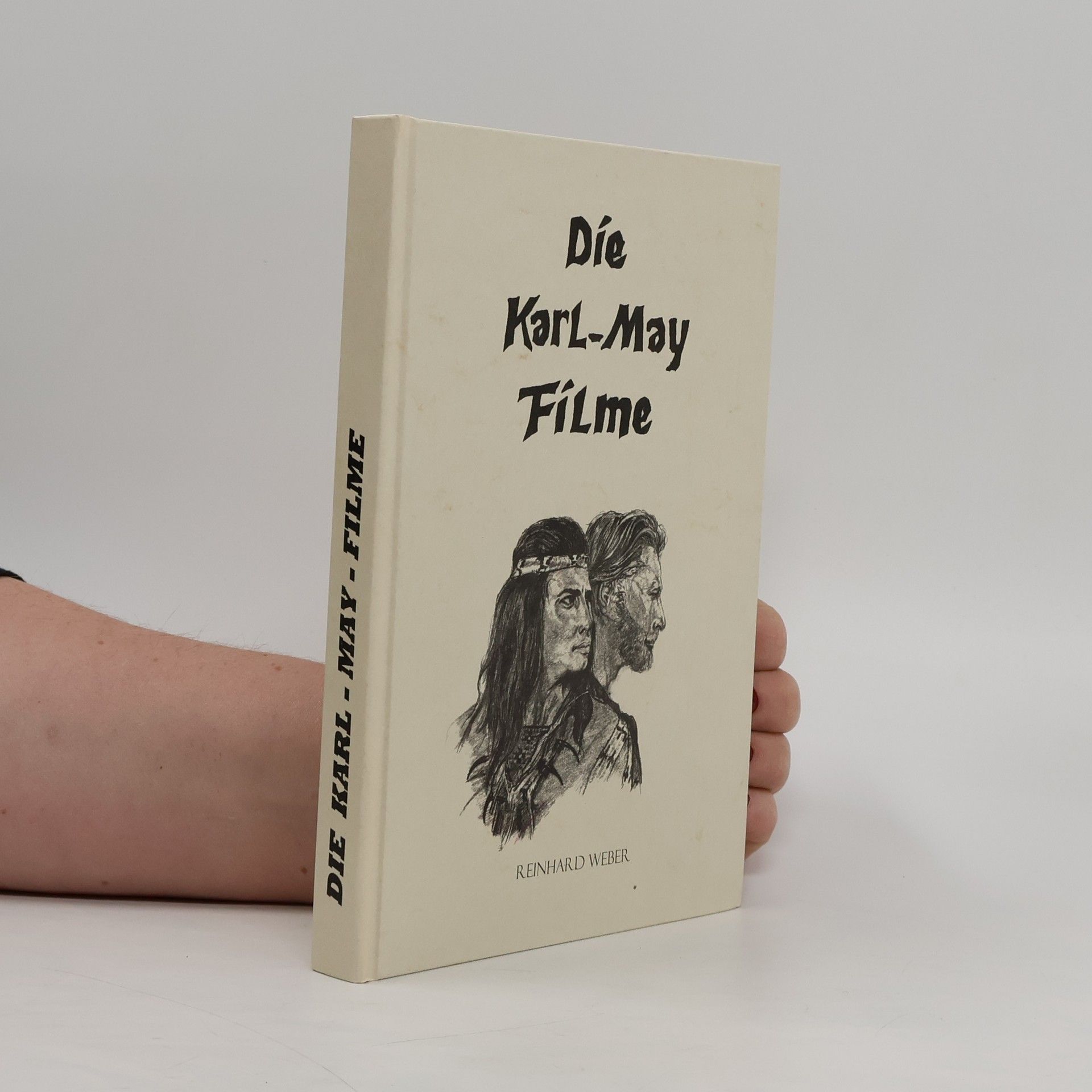
„Ungewöhnliches Lesevergnügen versprechen zwei Bände aus dem Reinhard Weber Fachverlag für Filmliteratur: Verlagsgründer Reinhard Weber verfasste „Die Mad Max Trilogie“, die, von den Anfängen der australischen Filmkunst ausgehend, ein Kapitel über den Schöpfer George Miller, Produktionsberichte, Kritiken, Stabangaben, etc. der drei Werke liefert.“ Treffpunkt Kino, 10/99 „Nach einem Kurzüberblick „Von den Anfängen australischer Filmkunst bis Mad Max“ stellt er uns Regisseur George Miller vor und behandelt die Filme unter den Gesichtspunkten „Produktion“, „Kritiken/Analysen“ und „Stab/Inhalt“. Das alles geschieht kenntnis- und materialreich.“ Der Schnitt 2/99
Hitler-Prozess 1924 (2)
- 424 páginas
- 15 horas de lectura