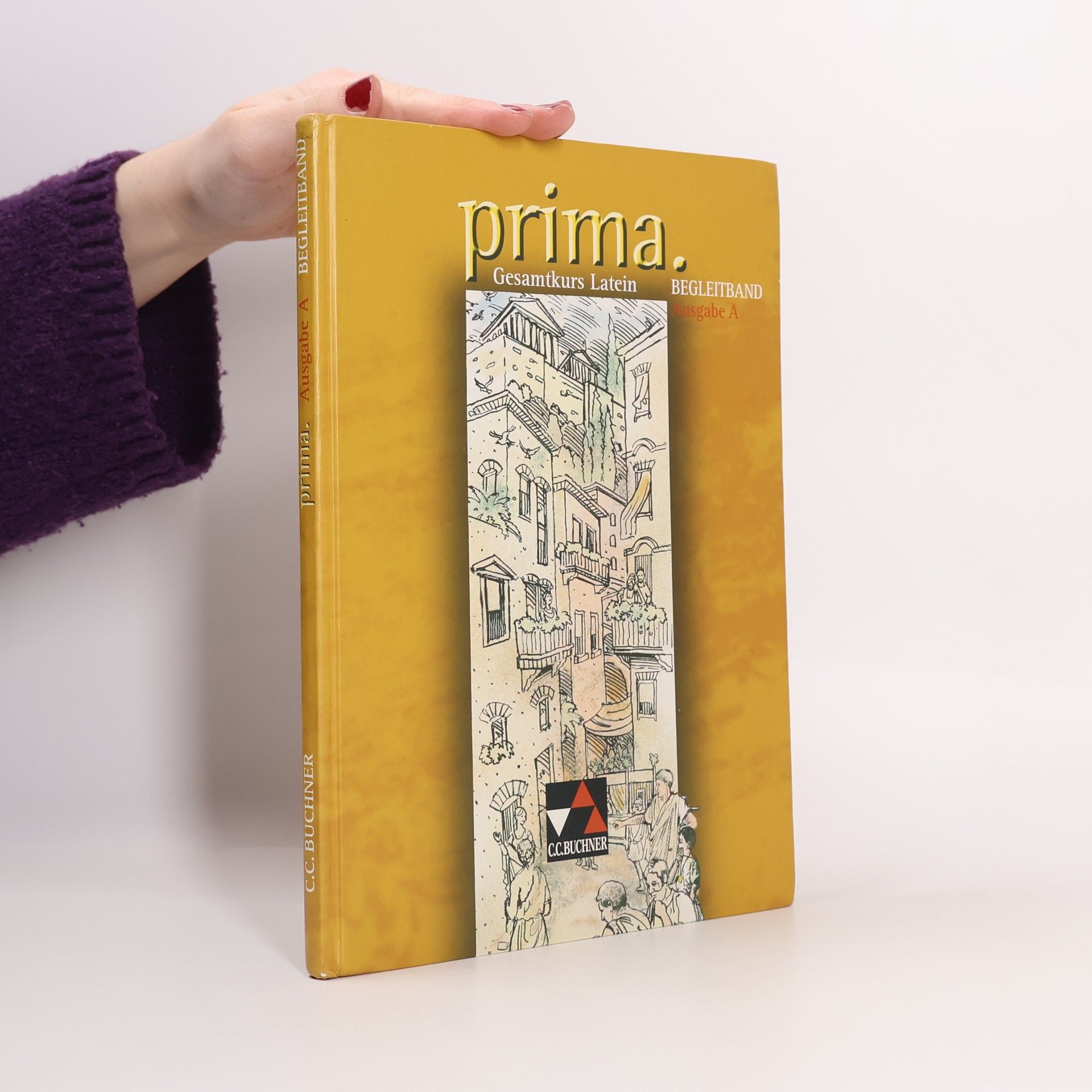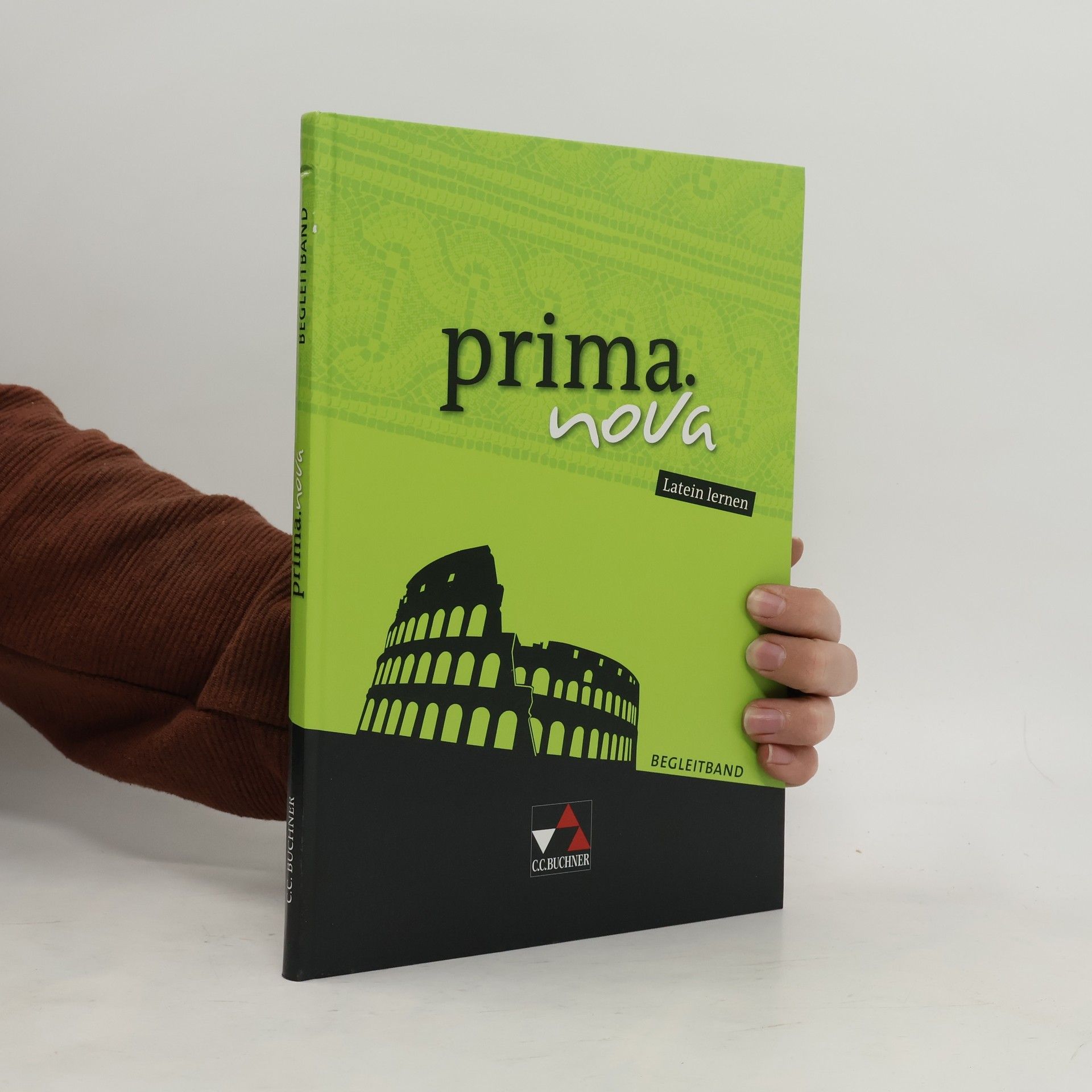Prima.nova
- 178 páginas
- 7 horas de lectura
Mit prima. nova haben wir die Prinzipien des Erfolgsmodells prima weiterentwickelt: Eingeflossen sind die neueren Erkenntnisse der Didaktik und Bildungsforschung sowie die Erfordernisse veränderter Lehrpläne. prima. nova setzt neue Akzente: Lehrgang mit 45 Lektionen (44 Stofflektionen und ein mehrgliedriges Additum) stoffliche Umstellungen und Straffungen – vor allem an der Schwelle zur Erstlektüre – gemäß den gültigen Bildungsstandards und Curricula Kennzeichnung von obligatorischen und fakultativen Stoffbausteinen konsequente Kompetenzorientierung der Aufgaben und Übungen mit zusammenfassenden Reflexionsseiten am Ende einer jeden Sequenz Binnendifferenzierung und individuelle Förderung als neuer Schwerpunkt Optimierung der Lektionstexte, Neugestaltung des Layouts, intensive Vernetzung der Bebilderung mit den Texten Bewährte prima-Prinzipien wurden beibehalten: die thematische Gliederung nach Sequenzen die Verteilung der konstitutiven Elemente einer Lektion auf vier Lehrbuchseiten die Didaktik der Vorentlastung die Ausrichtung des Vokabulars am Bamberger Wortschatz die Möglichkeit, den Sprachlehrgang nahtlos mit der Bamberger Bibliothek fortzuführen