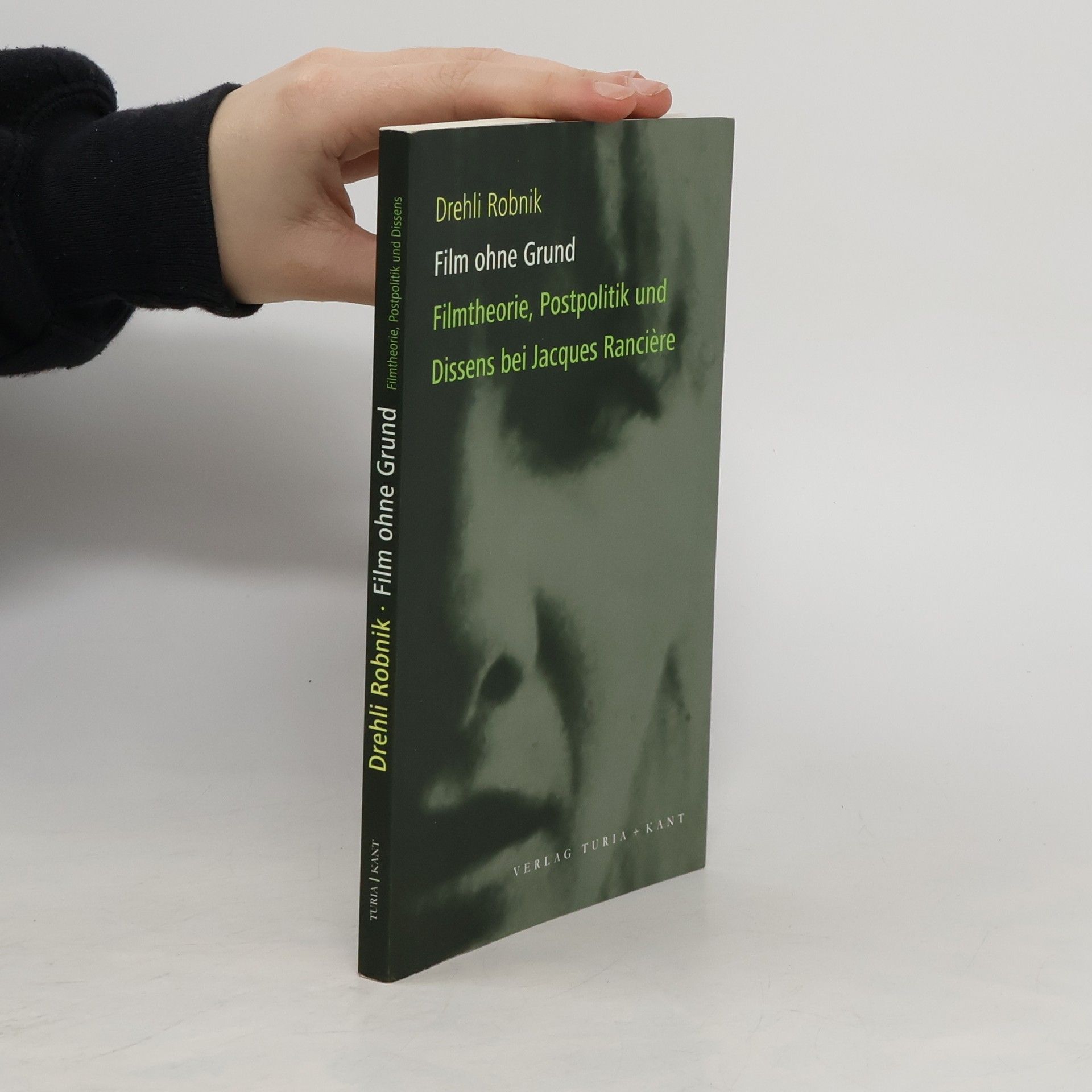Klassen sehen
Soziale Konflikte und ihre Szenarien
Klasse ist nie ganz da, aber immer wirksam. Es gibt sie als stets vorausgesetzte Einteilung und im Klassenkampf. Und es gibt Klasse vermittels von ›Bewusstsein‹, sei dieses nun Stolz oder Analyse, indiskrete Scham des Proletariats oder konkrete Schamlosigkeit der Bourgeoisie. Solche Aspekte von Klasse werden in diesem Band anhand von Wohnbauplanung, Kunst und Medien untersucht. Es geht um Kapitalien und Wir/Sie-Grenzen, politische Anschlüsse und soziale Ausschlüsse in Bauten, Bildern und Ausbildungsprozessen. Und es geht um 'Einstellungen' – im Sinn von Film- und Video-Aufnahmen, von ideologischen Sichtweisen und Ausblendungen sowie von Einstellungsgesprächen und Bewerbungsschreiben als Einübungen in Machtverhältnisse.