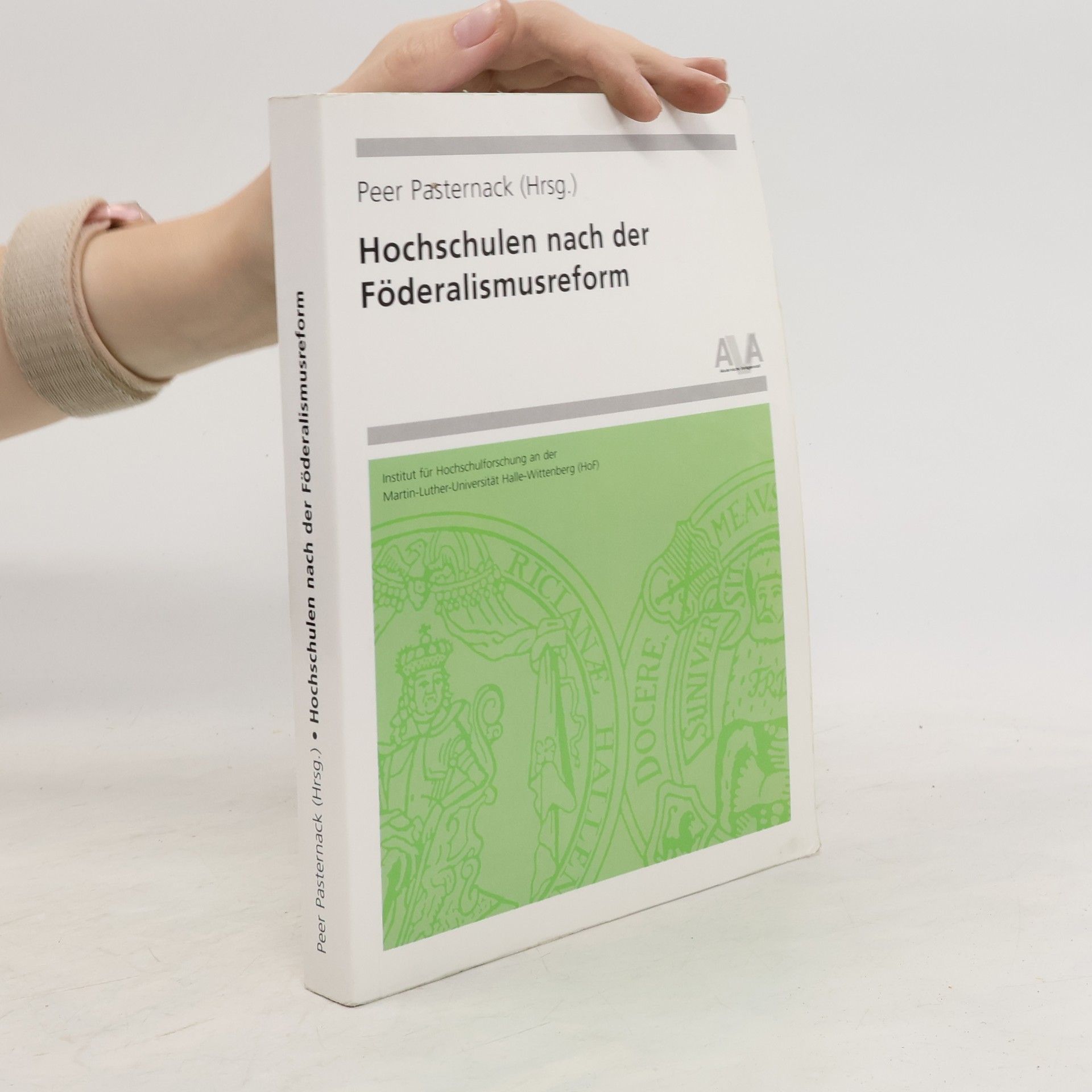Von Campus- bis Industrieliteratur
Eine literarische DDR-Wissenschaftsgeschichte
- 652 páginas
- 23 horas de lectura
Die Belletristik in der DDR diente als Ersatzöffentlichkeit, insbesondere im Bereich der Wissenschaftsliteratur, die etwa 150 Werke umfasst. Der Band analysiert, wie diese Literatur das Thema "Wissenschaft in der DDR" aufbereitet und aufzeigt, welche wertvollen Informationen sie für die zeitgeschichtliche Forschung bietet. Peer Pasternack, ein erfahrener Sozialwissenschaftler und Zeithistoriker, nutzt rund 25 Studien zur Wissenschafts- und Bildungsgeschichte der DDR, um die Relevanz und die bislang ungenutzten Erkenntnisse dieser Belletristik zu verdeutlichen.