Dieter Bahr Libros
Hans-Dieter Bahr es un filósofo y profesor universitario alemán. Fue el primer estudiante de doctorado de Ernst Bloch en Tubinga (1968). Desde el año 2000, está jubilado en Tubinga.

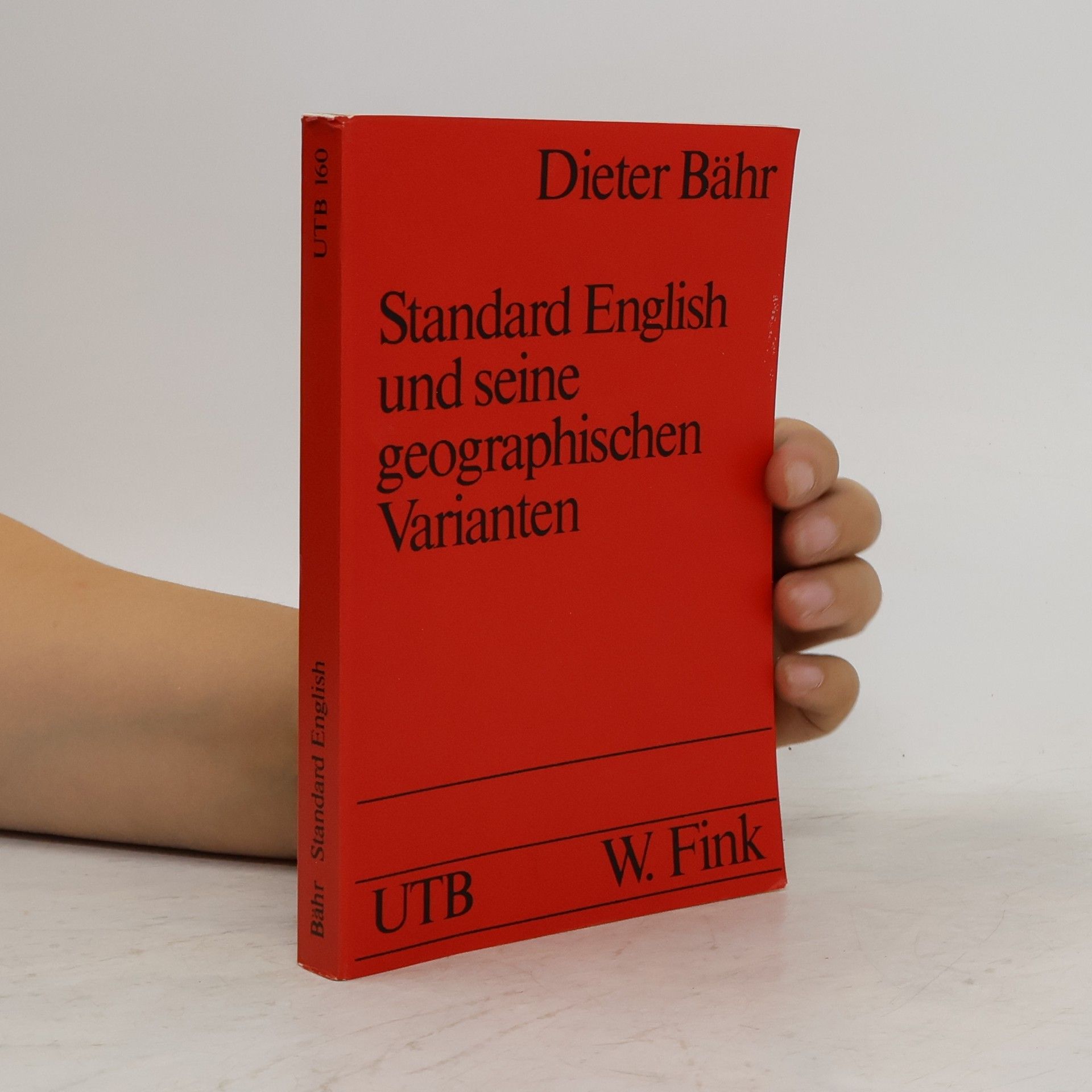
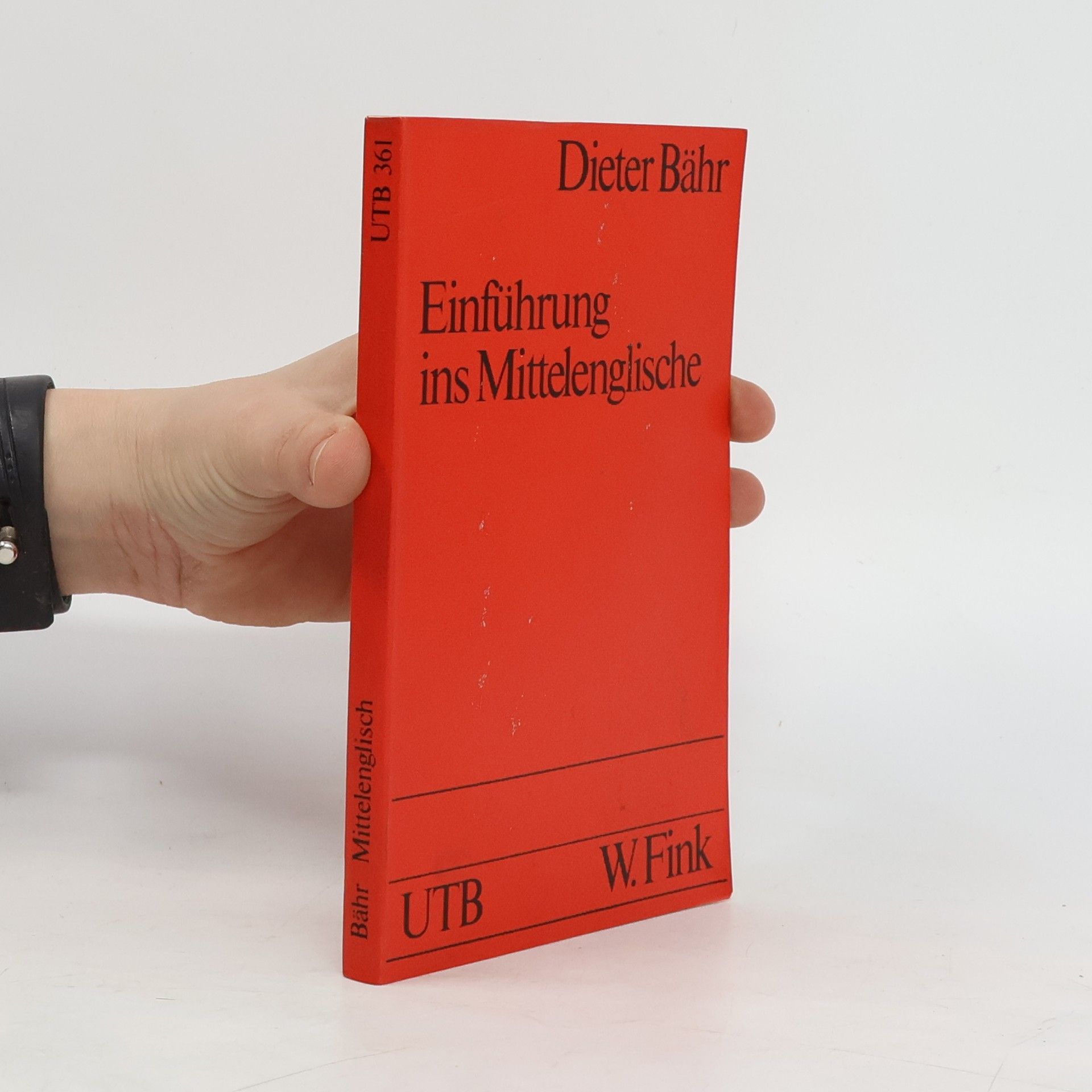
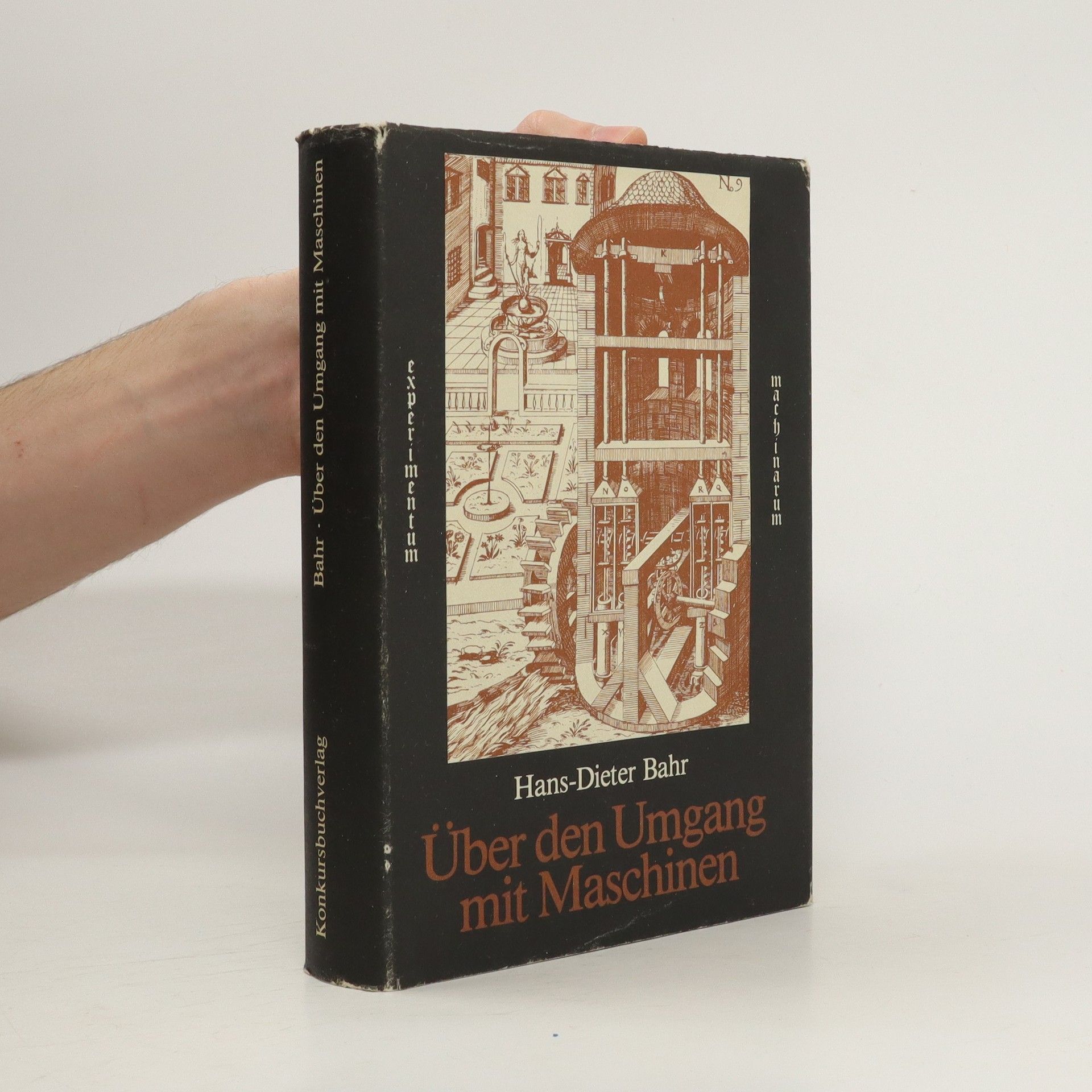
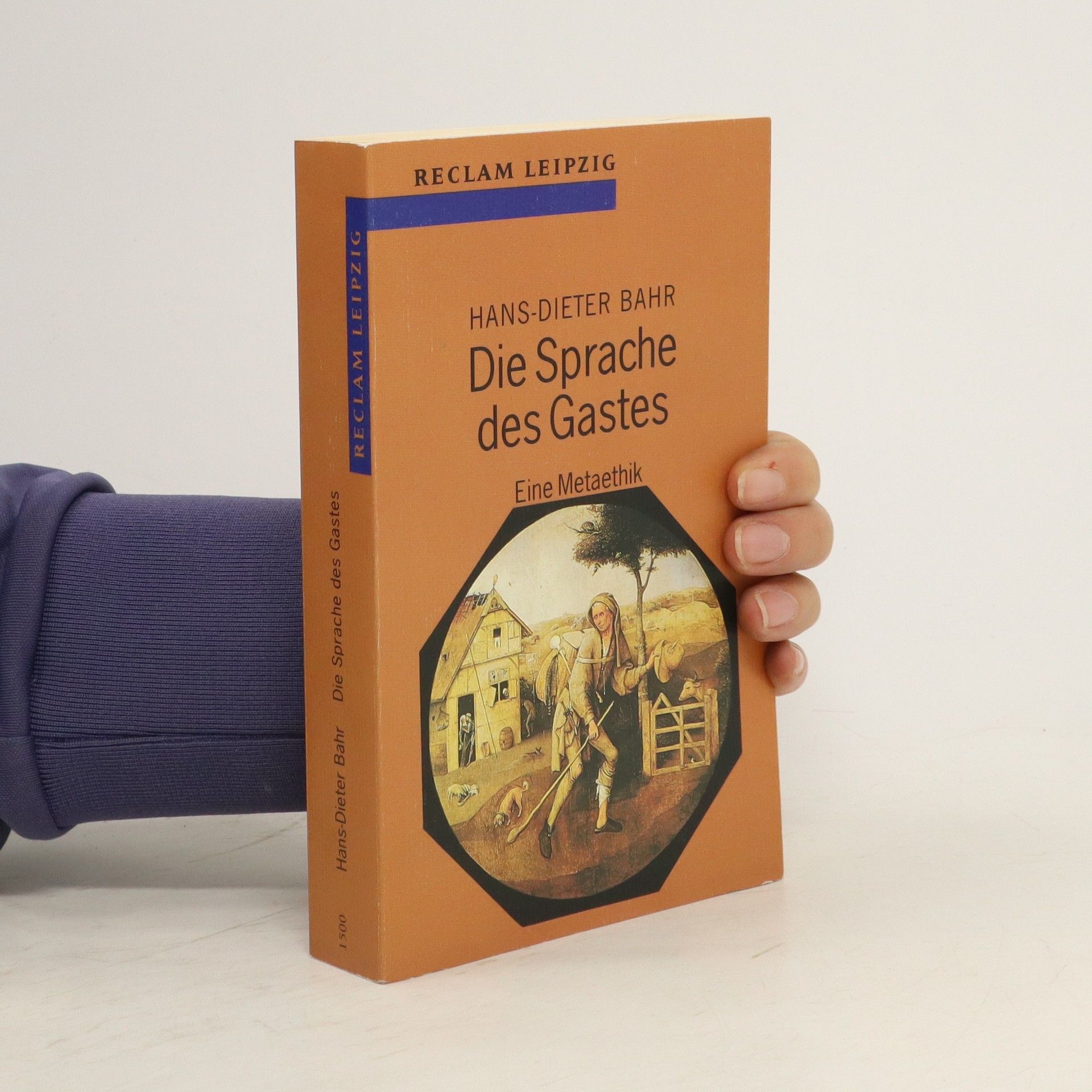
Über den Umgang mit Maschinen
- 512 páginas
- 18 horas de lectura
UTB - 2212: Abriß der englischen Sprachgeschichte
Nebst spätmittelenglischen Sprachproben
- 196 páginas
- 7 horas de lectura