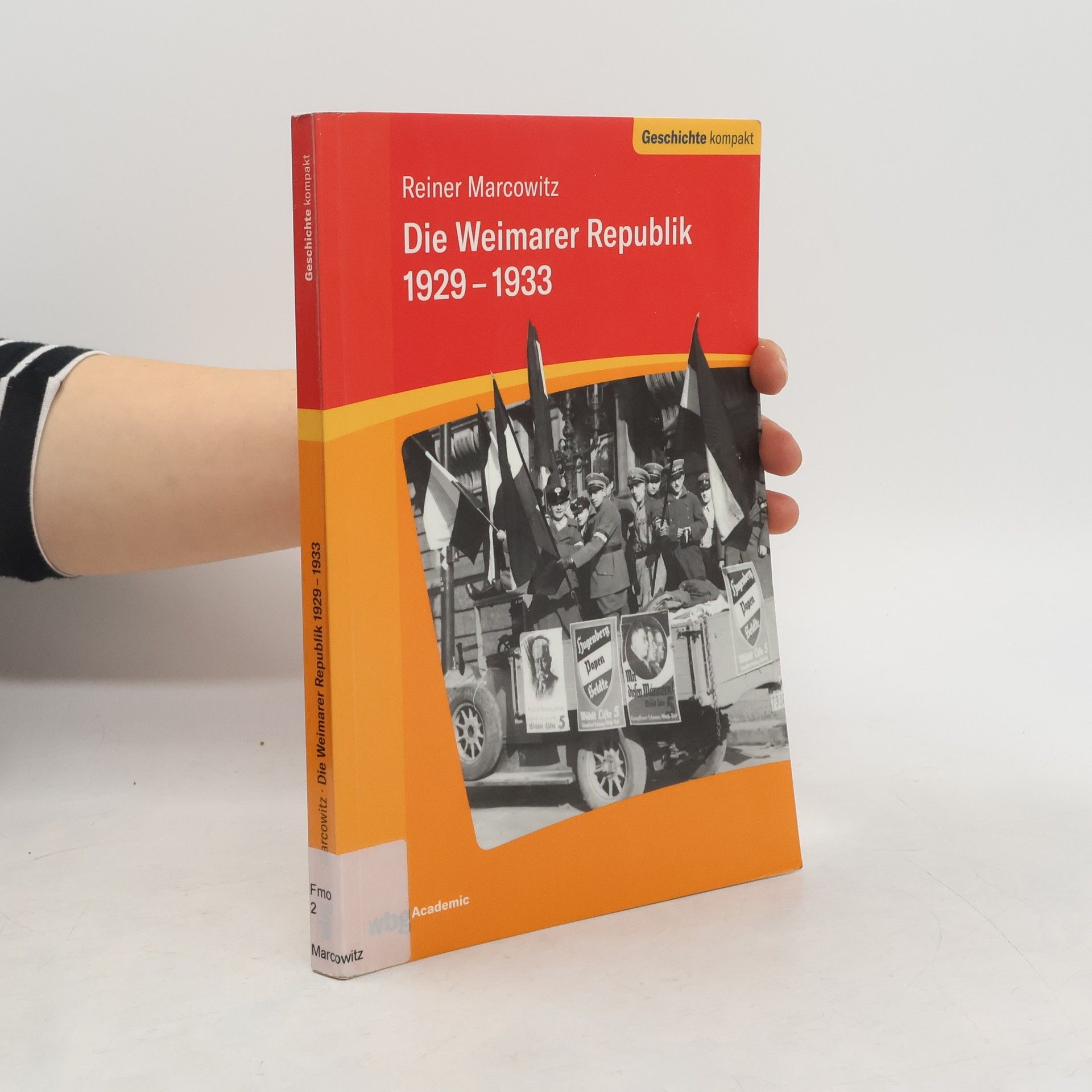Die Weimarer Republik 1929-1933
- 160 páginas
- 6 horas de lectura
Die bewegten 14 Jahre der Weimarer Republik stellen eines der zentralen Themenfelder der Geschichtswissenschaft dar. Insbesondere die Endphase 1929-1933 wird bis heute kontrovers diskutiert. Reiner Marcowitz analysiert diese Krisenzeit der ersten deutschen Republik unter strukturellen wie chronologischen Gesichtspunkten. Er schildert ausführlich die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise. Dann untersucht er die Entwicklung der Großen Koalition, der letzten demokratisch legitimierten Regierung Weimars, und die Regierungszeiten der folgenden Präsidialkanzler Brüning, Papen und Schleicher. Schließlich analysiert er den Aufstieg der NSDAP zur ›Volkspartei‹ und die nationalsozialistische Regierungsübernahme am 30. Januar 1933.