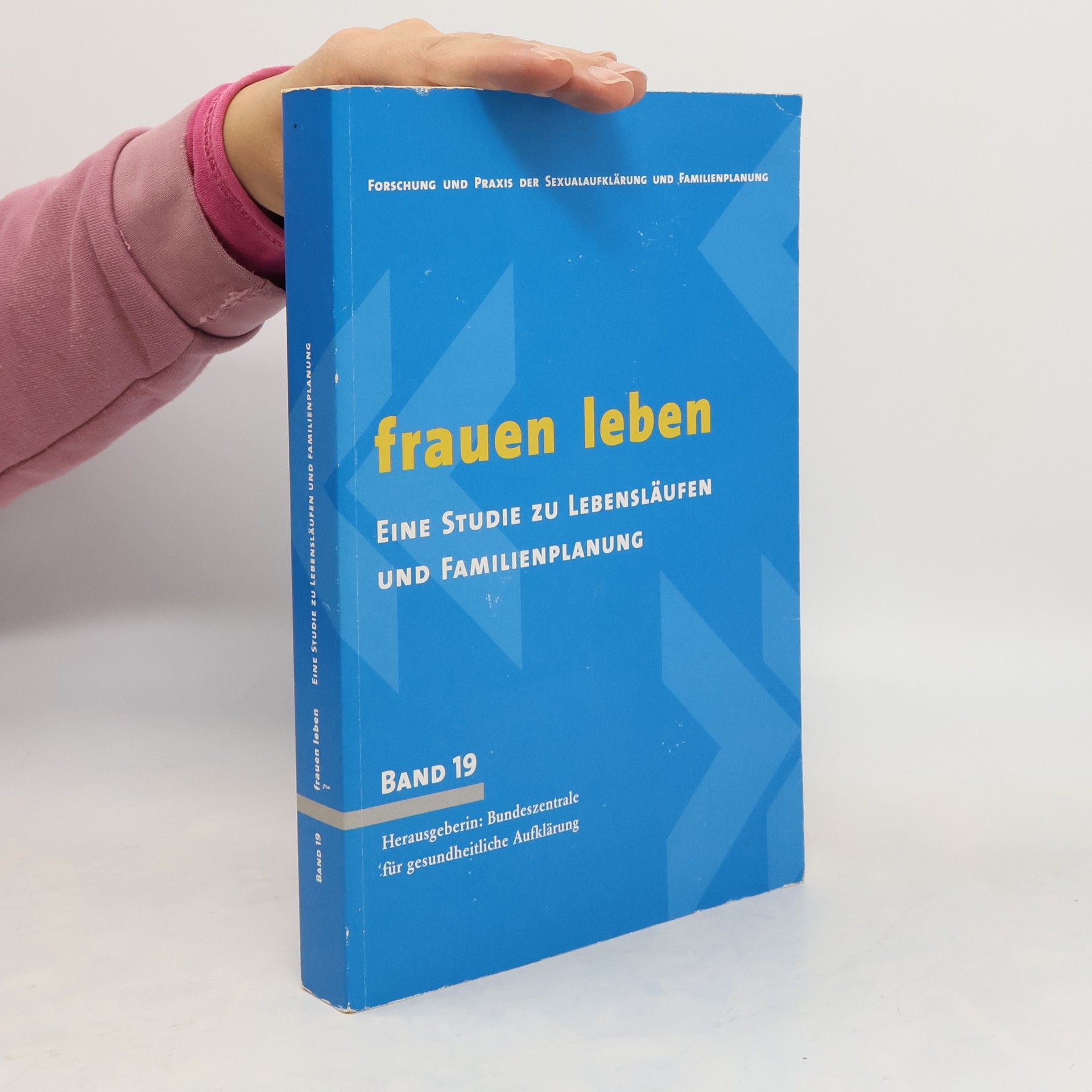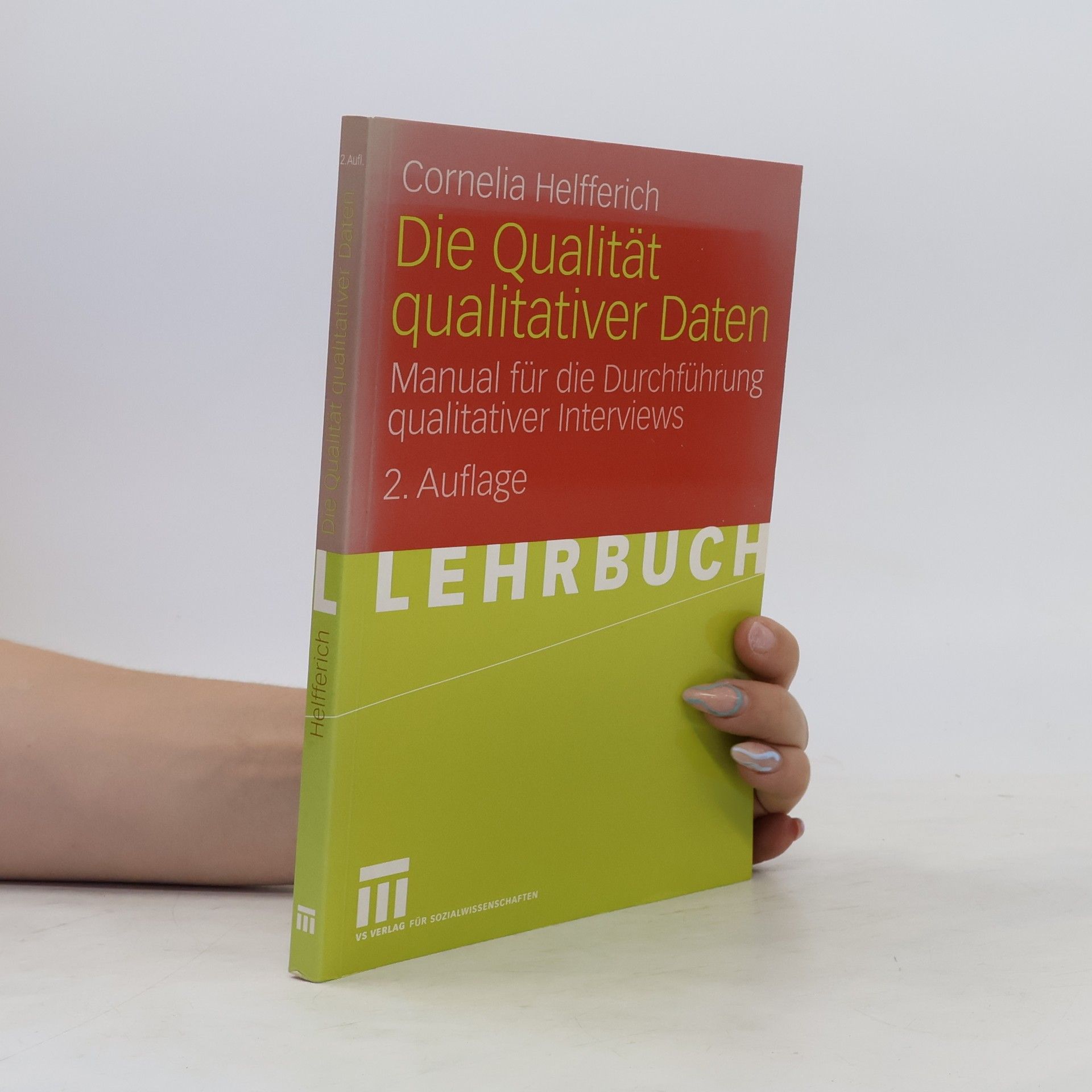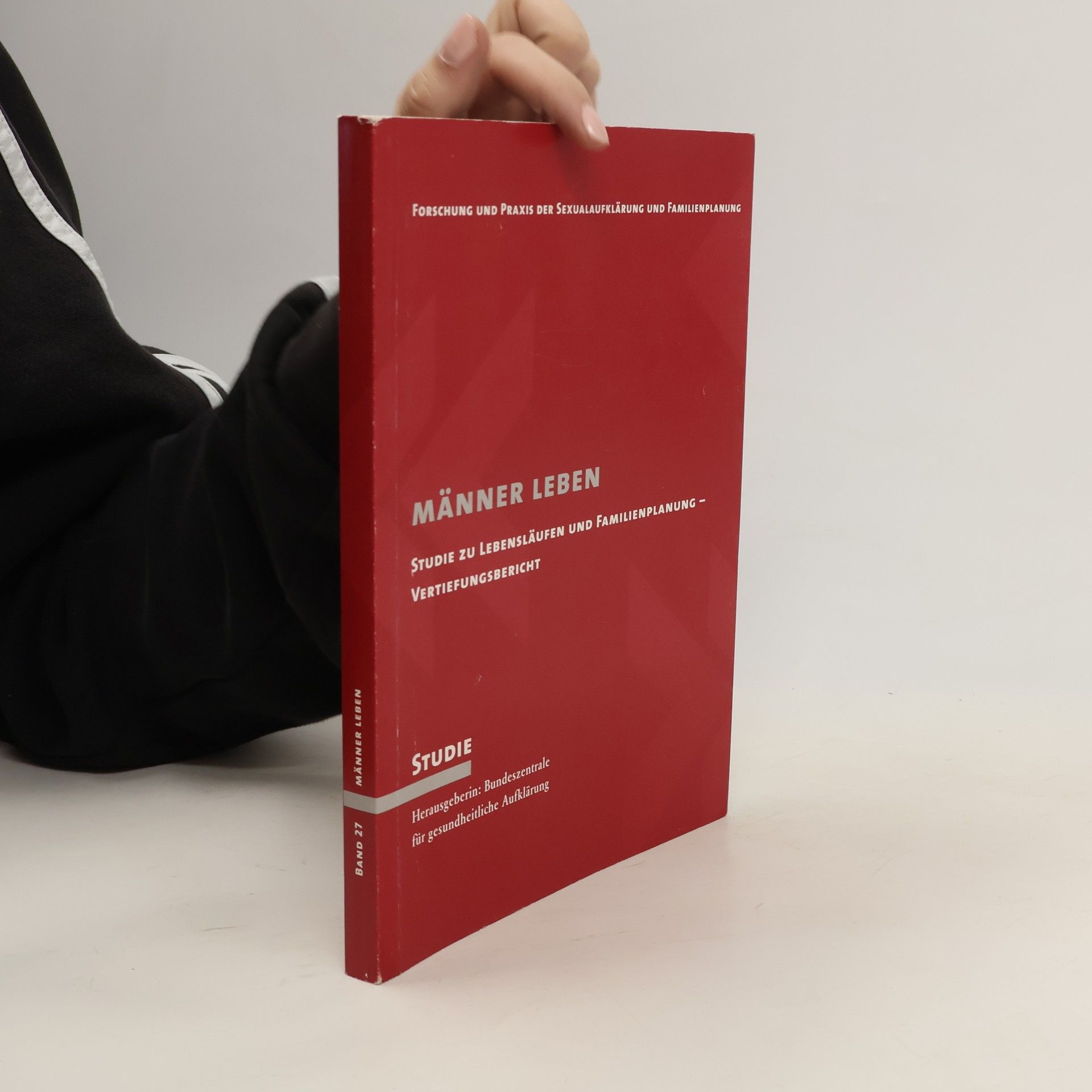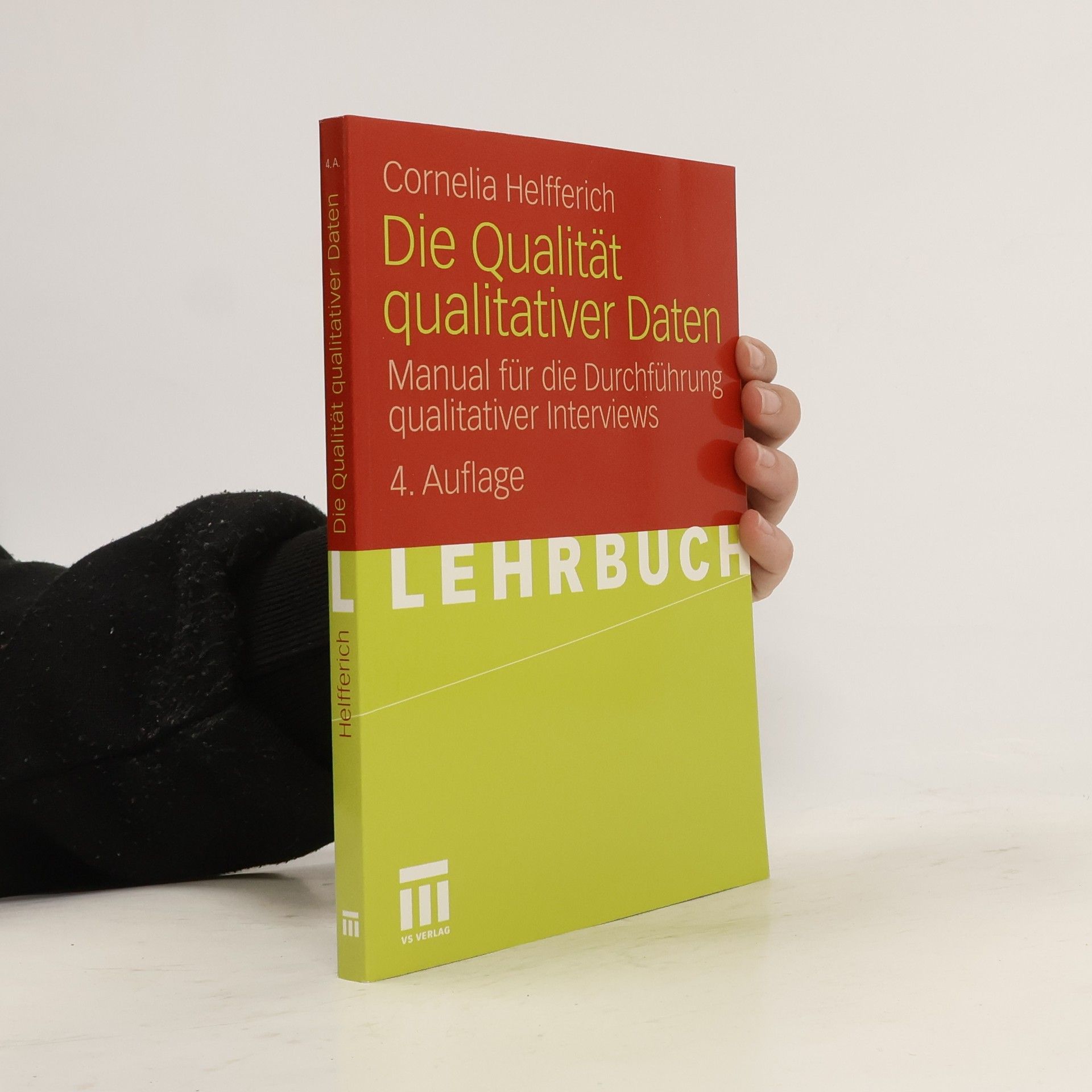Die Qualität qualitativer Daten
Manual für die Durchführung qualitativer Interviews
- 216 páginas
- 8 horas de lectura
Wie führt man ein "gutes" qualitatives Interview? Fragt man überhaupt - wenn ja: Wie? Welche Formen qualitativer Interviews gibt es? Wie erstellt man einen Leitfaden? Das Manual beantwortet diese und andere Fragen und will den praktischen Nöten derjenigen abhelfen, die qualitative (narrative, problemzentrierte oder Leitfaden gestützte) Einzelinterviews für Forschungsprojekte oder im Rahmen von Qualifikationsarbeiten durchführen wollen. Es vermittelt alle Kompetenzen, die notwendig sind, um das qualitative Interview als Kommunikations- und Interaktionsprozess zu reflektieren und bewusst zu gestalten. Das Buch enthält Übungen, theoretisches Hintergrundwissen, Forschungsbeispiele, praktische Informationen, z.B. zum Datenschutz, sowie hilfreiche Materialien zur Organisation des qualitativen Forschungsprozesses. Das Manual kann für die Vorbereitung auf die Interviewdurchführung in Interviewschulungen oder im Selbststudium genutzt werden und bietet Anregungen für die Lehre qualitativer Forschungsmethoden.