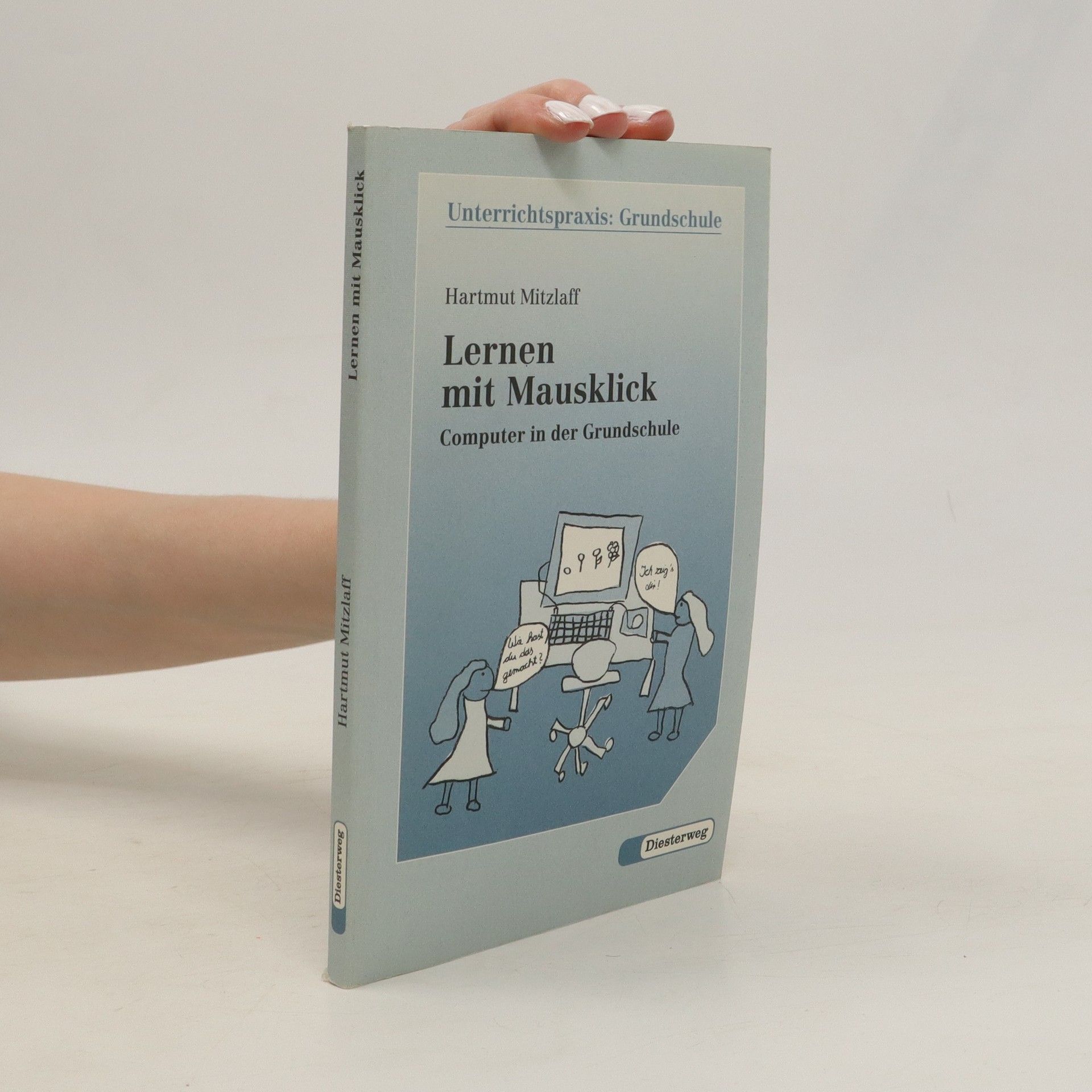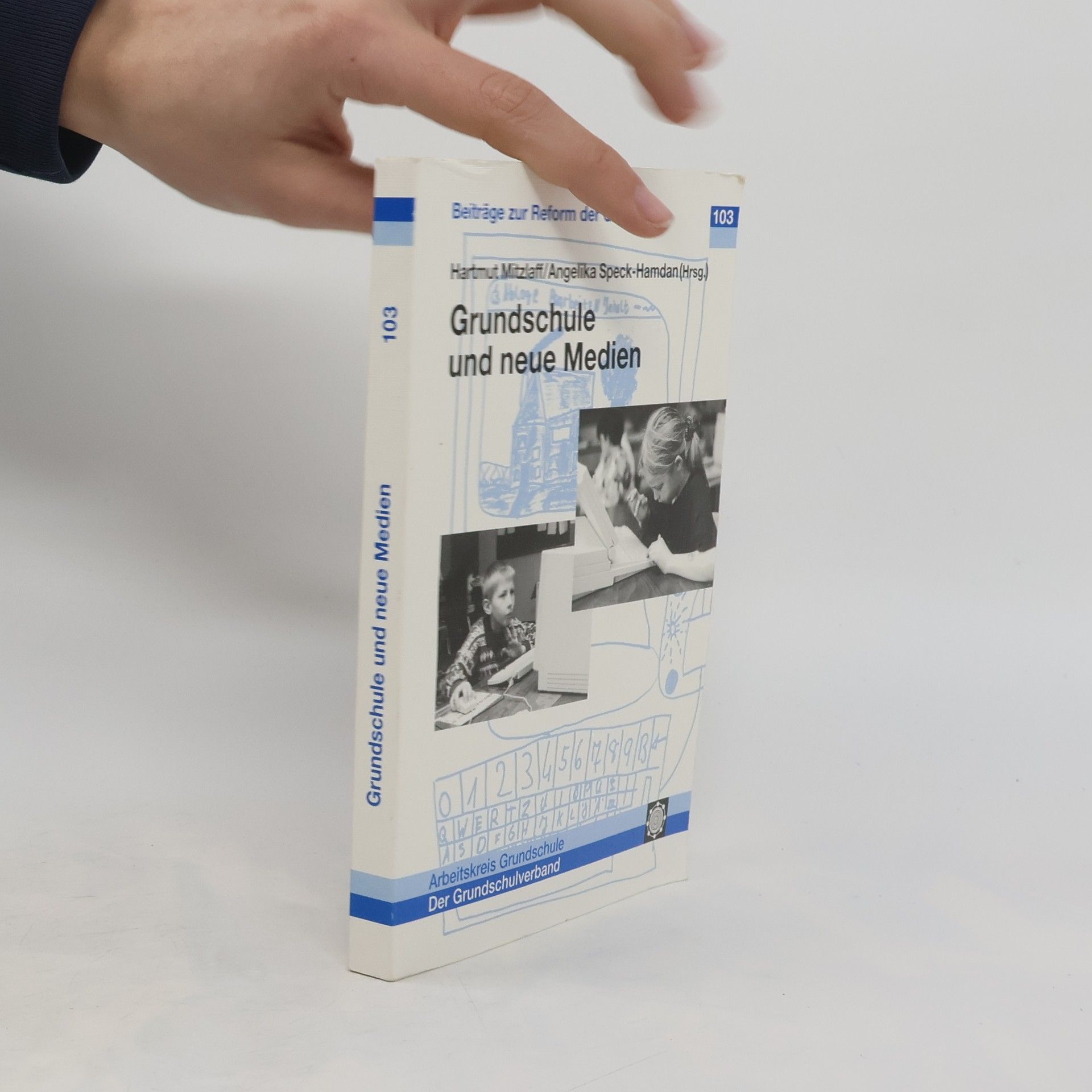J.W.M. Henning (1783-1868)
Aus dem Leben und Werk eines Pommerschen Pestalozzi-Schülers und Schulreformers des neunzehnten Jahrhunderts.Von Rügenwalde über Stettin, Halle, Basel, Yverdon, Breslau und Bunzlau nach Köslin und Zürich
Dieses Buch beschreibt das Leben und Werk des vergessenen Theologen und Pädagogen Johann Wilhelm Mathias Henning (1783-1868) aus Rügenwalde. 1809 gehörte er zu den 17 Schülern, die der Preußische Staat zu Pestalozzi nach Yverdon schickte, um dessen Methodik zu studieren und in Preußen umzusetzen. Nach seiner Rückkehr wurde Henning ein unermüdlicher Multiplikator der Pestalozzischen Ideen und einer der ersten Biographen Pestalozzis. 1812 stellte er seine Methodik der „Elementargeographie“ vor, die später von Christian Wilhelm Harnisch als „Heimathskunde“ aufgegriffen wurde. Während Harnisch als „Vater der Heimatkunde“ gilt, geriet Henning zunehmend in Vergessenheit. Gemeinsam gründeten sie 1813/14 in Breslau einen der ersten deutschen Schullehrervereine und Henning leistete grundlegende Beiträge zur „Schulrath an der Oder“, der ersten professionellen Lehrerzeitschrift im deutschen Sprachraum. Von 1827 bis 1851 war Henning Direktor des Königlichen Lehrerseminars in Köslin, das er nach Pestalozzischen Grundsätzen ausbaute. Er legte 1828 ein fortschrittliches Konzept für die Volksschulen der Region vor und veröffentlichte 1830 anonym seine Pommersche Landes- und Volkskunde, die 25 Auflagen erreichte. 1834 gründete er einen Lehrerverein in Pommern und gab ab 1835 ein Monatsblatt für Volksschullehrer heraus. Zusammen mit P. F. Theodor Kawerau und K. A. Gottlieb Dreist wird er als Teil des „Pestalozzianischen Kleeblatts“ beschrieben,