Building Paradise
A Basel Manor House and its Residents in a Global Perspective
- 235 páginas
- 9 horas de lectura
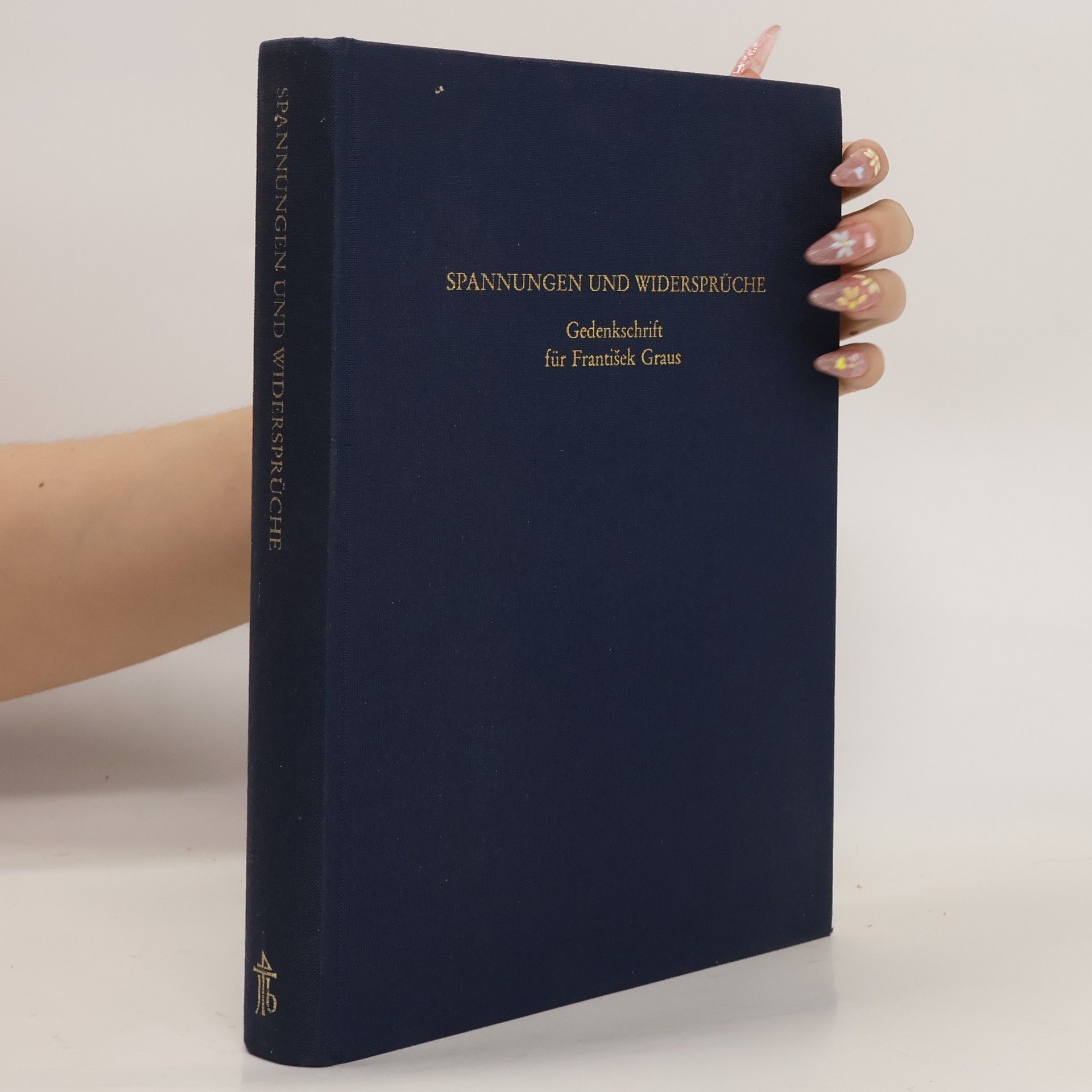


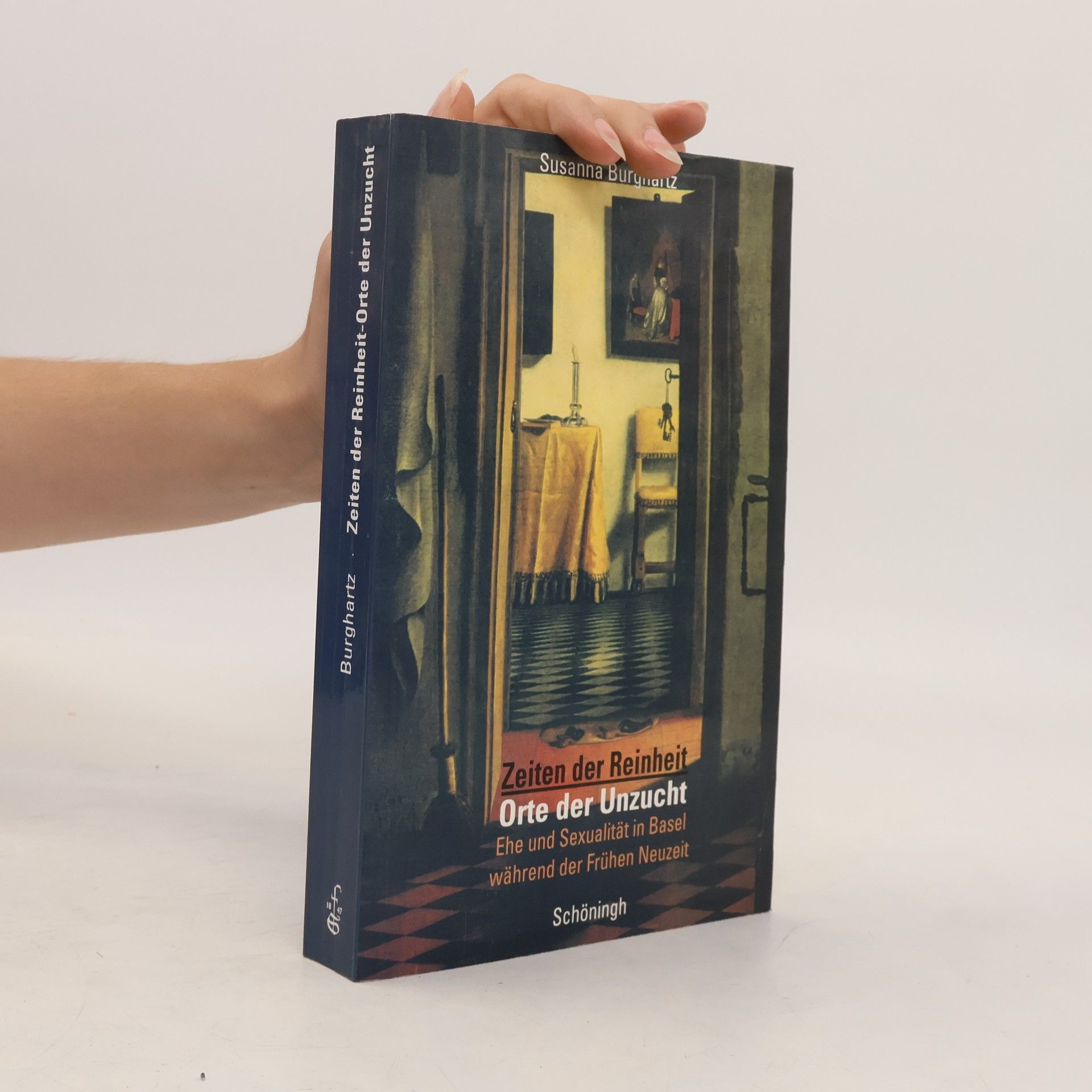

A Basel Manor House and its Residents in a Global Perspective
Ein Basler Sommerpalais und seine globalen Bezüge
Mitte des 18. Jahrhunderts liess der Basler Seidenbandfabrikant Achilles Leissler (1723-1784) an der Riehenstrasse ein beeindruckendes Sommerhaus erbauen, das als Sandgrube bekannt wurde. Das Gebäude fügt sich in die beträchtliche Anzahl reich ausgestatteter Residenzen ein, welche die Strasse von Kleinbasel nach Riehen säumten. Mit ihren bemerkenswerten Gärten voller exotischer Pflanzen repräsentierten sie nicht nur die wirtschaftlichen Eliten einer reichen Stadt, sie befanden sich auch in direkter Nachbarschaft jener Produktionsstätten, die Baumwolle und Seide durch spezielle Färbe- und Druckverfahren veredelten und damit einen globalen Markt bedienten. Die Publikation erkundet die denkmalgeschützte Sandgrube und ihre international agierenden Bewohner. Damit öffnet sich der Blick für die frühe Partizipation Basels in einem globalen Markt und für die Auswirkungen, welche Produktion und Handel globaler Güter auf das Gemeinwesen der Stadt und deren Selbstverständnis hatten.
Band 4 der Stadt.Geschichte.Basel erzählt von den raschen Umbrüchen und langsamen Transformationen zwischen Reformation und Revolution. Der Zeitraum von 1510 bis 1790 ist durch dynamische Aufbrüche und grosse Beharrungskräfte geprägt. Religiöse Erneuerungsbewegungen fordern die kirchliche Orthodoxie heraus. Die wachsende Konzentration der Macht auf wenige Familien geht mit ersten Ansätzen zu einer modernen Verwaltung einher. Das traditionsbewusste Zunftwesen konkurriert mit frühkapitalistischen Wirtschaftsformen. Typisch für Basel sind die internationale Vernetzung von Kaufleuten und Gelehrten ebenso wie die lokale Ausrichtung des Alltags.